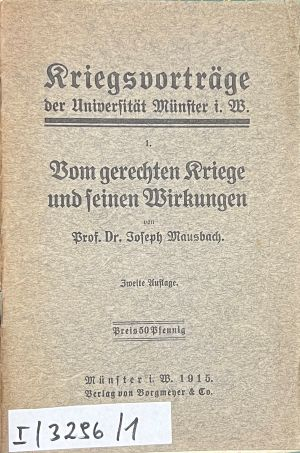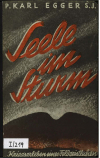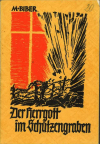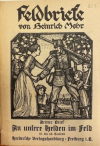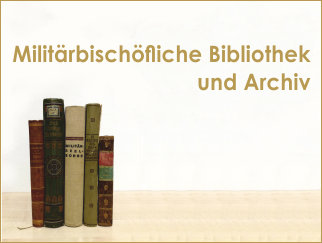Die hier abgedruckte Rede des bedeutenden Moraltheologen Joseph Mausbach eröffnet eine Reihe von Kriegsvorträgen von Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachbereichen der Universität Münster.
An seinem Text fällt vor allem auf, dass die Beschreibung und das Lob moralischer Gefühle im Vordergrund steht, während die ethische und moraltheologische Argumentation eher zurückzutreten scheint. Die Sprache ist voll von nationalem Pathos, nicht nur am Anfang, wo er darauf hinweist, dass die Zeit der Kriegserklärungen, des Kriegsbeginns „kein böser Tag, keine Stunde der Finsternis“ (3) war, wie es zunächst den Anschein hatte. Vielmehr war es „eine Stunde, da trotz aller Wolken die Sonne hoch am Himmel stand, und in ihrem Lichte goldene Saaten reiften und schwellende Trauben zu Wein erglühten“ (3). Die poetischen Bilder beziehen sich auf das kollektive „Auflodern eines heiligen Feuers“ (3) im Volk, seine Opferbereitschaft und Tapferkeit.
Wenn Mausbach auch die moraltheologische Überzeugung der Überordnung des Friedens über den Krieg nicht unterschlägt und das Christentum im Einklang mit der Tradition als „Religion des Gottesfriedens und der Nächstenliebe“ (8) bezeichnet, so ist damit keine Geringschätzung des Krieges verbunden. Weil echte Liebe „auch wehtun und strafen“, „versagen und verwunden“ können muss, „um die Menschen zu den wahren Quellen des Heils und Friedens zurückzuführen“ (8) und individuelle Notwehr in Lebensgefahr erlaubt ist, darf auch der Staat „zum Schwerte greifen“ (9), um die Gerechtigkeit und die höchsten sozialen und nationalen Güter zu schützen. Diese Grundüberzeugung verknüpft Mausbach mit jenen bekannten Sujets, die in vielen zeitgenössischen Texten zu finden sind: der existenzielle Kampf um „Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens“ (11), die moralisch durchweg positive Wertung der Begeisterung für den von den Gegnern aufgezwungenen Krieg, der zudem den fortschreitenden moralischen Verfall in der deutschen Bevölkerung vor dem Krieg in Windeseile rückgängig macht und Einheit zwischen den politischen und sozialen Gruppen bewirkt.
Mausbach bezieht sich weiters positiv auf das „Gott will es“ der Kreuzzugszeit, aber er sagt dabei nicht direkt, dass Gott den Krieg will. Vielmehr spricht er von einer aktiven, mit dem eigenen Tun vermittelten heiligen Notwendigkeit. Sie „‚vollstreckt‘“ (19) den Willen Gottes, hat die Massen erfasst und „in die Knie gezwungen auf den Ruf des Kaisers“ (19) – ist also auch durch den Herrscher vermittelt. Schließlich gerinnt sie – ethisch vermittelt – zur Aufforderung, die Waffenrüstung Gottes zu ergreifen: Denn in ihr liege eine moralische Macht, die Leidenschaft und Zügellosigkeit eindämmt und dadurch [lediglich indirekt] „den äußeren Sieg erleichtert“ (20).
An der vielleicht bemerkenswertesten Stelle räumt Mausbach ein, dass es sich bei den so positiv hervorgehobenen Phänomenen im Bewusstsein des Volkes bloß um „Tugenden des Augenblicks, heroische Aufwallungen“ handelt, die die „stillen Tugenden des Friedens“ (17) nicht ersetzen können. Allerdings basieren sie auf diesen wichtigeren moralischen Qualitäten, die der Krieg nur sichtbar macht: „was stille, verborgene Friedensarbeit an sittlichen Kräften dem Volke eingesenkt hat, das wird nun bewährt wie Gold im Feuerofen“ (17). Mausbach geht davon aus, dass etwa Verweichlichung oder „moderne Auswüchse der Freiheit und Lebenslust“ (16) die moralische Qualität des Volkes nicht in der Wurzel korrumpiert hat: Das „deutsche Volk hat sich trotz mancher Verführung und Ankränkelung einen so gesunden Kern physischer, moralischer und wirtschaftlicher Tüchtigkeit bewahrt“ (23f), dass man den Sieg im Krieg und eine „höhere Machtstellung deutschen Wesens und deutscher Kultur erwarten“ (24) darf. Freilich ist das aus christlicher Sicht nicht das Entscheidende: Das sittliche Endziel ist das ewige Leben, nicht „die Macht und Größe der Nation“ (22). Auch die Erniedrigung des Volkes, selbst eine Fremdherrschaft müsste man erdulden, ohne den religiösen Glauben und die sittliche Kraft zu leben aufzugeben – eine der feinen Relativierungen des im selben Text durchaus eifrig bedienten Gestus nationaler moralischer Selbstvergewisserung.
Joseph Mausbach: Vom gerechten Kriege und seinen Wirkungen (Kriegsvorträge der Universität Münster i.W. 1), Münster i.W. 2/1915, 24 Seiten, Sprache: deutsch
Buchnummer MBBA: 24850