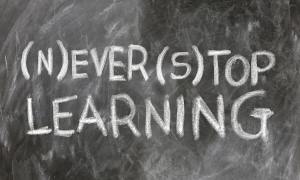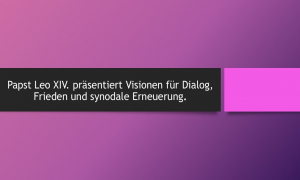Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Mit Gottes Hilfe in den Krieg? Gottes Segen für das Töten? Die Seelsorge für Soldatinnen und Soldaten hat einen anderen Blick, sagt Militärseelsorger Richard Weyringer. Der Salzburger Pfarrer gibt einen Einblick in seine Arbeit.
Soldatinnen und Soldaten setzen sich im Einsatz in Kriegsgebieten häufig belastenden Situationen und echten Gefahren aus.
Nicht selten müssen sie um die eigene Unversehrtheit bangen. Für sie gibt es Militärseelsorger, die mit ihnen die Schrecken und die weitergehenden Fragen danach verarbeiten. Einer davon ist Richard Weyringer vom Militärkommando Salzburg. Der 59-Jährige ist seit bald zwanzig Jahren Priester und seit fünfzehn Jahren Militärseelsorger. Unter anderem war er bei den österreichischen Blauhelmen im Libanon eingesetzt, wo mit einem Mandat der Vereinten Nationen die Grenze zu Israel kontrolliert wird.
„Raue Schale – weicher Kern“
Richard Weyringer ist nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Er ist der Typ „raue Schale – weicher Kern“. Deshalb machen ihn Behauptungen wütend, er sei Kriegführender im kirchlichen Gewand. „Wie das Wort Militär-Seel-Sorge schon aussagt, sorge ich mich als Priester um die Seelen der Soldatinnen und Soldaten. Es werden in der Militärseelsorge keine Waffen, sondern die mir anvertrauten Menschen gesegnet. Militärseelsorge ist für mich die Begleitung und seelsorgerische Betreuung der Soldaten.“
Militär und Seelsorge sind für Richard Weyringer kein Widerspruch.
Er, der vor seiner Priesterberufung bei der Spezialeinheit Jagdkommando Zeitsoldat war, führt beide Seiten zusammen. „Egal, ob ein Mensch eine Uniform trägt oder nicht – es geht uns in der Kirche um den Menschen und sein Heil. Jeder Mensch soll, wenn er will, kirchlich betreut werden. Katholiken haben ein Recht darauf, die Sakramente, die eine tiefe Verbindung zu Gott schenken, empfangen zu können. Soldaten haben die Aufgabe, ihr Land – und das bedeutet in erster Linie die Bewohner des Landes – zu schützen und zu verteidigen, ihnen in Not zu helfen unter Einsatz des Lebens. Dass gerade hier viel Segen notwendig ist, sollte klar sein.“
Fragt man Richard Weyringer, was ihm die Soldatinnen und Soldaten anvertrauen und was sie von ihm wissen wollen, reagiert der Priester einsilbig: „Eines kann ich sagen, es geht häufig darum, dass sie innerlich nicht im Gleichgewicht sind – beruflich oder privat. Mein Job besteht darin, im Gespräch und im Gebet zu helfen, dass wieder ein „Ruhezustand“ gefunden werden kann.“
In der Militärseelsorgewerden keine Waffen, sondern Menschen gesegnet
Militär arbeitet natürlich auch mit Psychologen zusammen. Richard Weyringer sieht seinen Auftrag als Ergänzung zu Psychologen und Psychologinnen. Er werde ja als „Mann Gottes“ angefragt, sagt er. „Da geht es dann um Vergebung, um Sinn, um Heil, wie können Brüche im Leben ganz gemacht werden.“
Weyringer, der gelernter Tischler ist und einige Jahre als Gastwirt gearbeitet hat, hat für alle ein offenes Ohr, egal woher sie stammen und was sie glauben. „Wenn sich jemand an mich wendet, ist meine erste Frage sicher nicht: „Bist du gläubig?“, sondern: „Wie geht es dir?“ Durch das Gespräch versuche ich, seinen seelischen Zustand zu erkennen und dann mit Gott und dem Glauben zu verbinden, denn darum wollen sie ja auch mit mir, einem katholischen Priester, sprechen.“
Richard Weyringers Leben verläuft nicht immer im Ausnahmezustand, er lebt nicht nur in Einsatzgebieten. Gesprächsbedarf herrscht unterm Jahr auch in Weyringers Heimatstandort, der Schwarzenbergkaserne in Salzburg und in seinen Pfarreien Hallwang und Walserfeld. Alltag in Salzburg hin, Einsatz im Libanon her: Hatte Richard Weyringer schon einmal Todesangst? „Bei meinem Einsatz im Libanon mussten wir beim gegenseitigen Beschuss der beiden Fronten sehr viel Zeit im Bunker verbringen. Das geht an die Substanz. Aber wir haben uns gegenseitig bestärkt, viel geredet, gemeinsam gelacht und gebetet. So konnten wir die Angst bewältigen.“
Richard Weyringer beendet jeden Tag mit dem Schuldbekenntnis. „So kann ich meinen Tag in Gottes Hand legen und Gott um seine Begleitung für den nächsten Tag bitten.“ Einen weiteren Tag an der Seite seiner Soldatinnen und Soldaten.
Text (leicht gekürzt) von Br. Michael Masseo Maldacker. Der Artikel ist zuerst in cap! erschienen, dem Magazin der Kapuziner. Den gesmaten Artikel finden Sie unter Militärseelsorge: „Hier ist viel Segen notwendig“ - Deutsche Kapuzinerprovinz
Wenn Sommerferien zur Zeit des Aufatmens und Aufbruchs werden – mit Impulsen, die bleiben.
Während viele den Sommer ausschließlich mit Sonne, Urlaub und Müßiggang verbinden, öffnen in ganz Österreich Bildungshäuser, Hochschulen und kirchliche Akademien wieder ihre Pforten für ein besonderes Angebot: Kirchliche Sommertagungen verbinden Erholung mit geistiger Auseinandersetzung, spirituelle Vertiefung mit aktueller Gesellschaftsanalyse. Zwischen Ende Juni und Anfang September bieten sie Raum für Fragen, Gespräche und Begegnungen – und laden dazu ein, die warme Jahreszeit auf besonders sinnstiftende Weise zu begehen.
Bildungstage mit Weitblick – Vielfalt an Themen und Orten
Die thematische Bandbreite der diesjährigen Sommertagungen ist bemerkenswert. Von bioethischen Dilemmata über pädagogische Vielfalt bis zu theologischen Grundfragen spannt sich ein Bogen, der gesellschaftliche, wissenschaftliche und spirituelle Dimensionen zusammenführt. Veranstaltungsorte sind unter anderem Linz, Salzburg, Innsbruck, Wels, Aigen im Mühlkreis und Tainach in Kärnten.
Einen starken Auftakt bildet die Internationale Bioethik-Sommerschule an der Katholischen Privat-Universität Linz (30. Juni–4. Juli). Unter dem Titel „Natur und Normativität“ wird hier das Verhältnis von Wissenschaft, Ethik und Schöpfungsverantwortung im Austausch mit internationalen Partneruniversitäten beleuchtet – ein Angebot für fortgeschrittene Studierende und Forschende mit Tiefgang.
Kurz darauf, vom 9. bis 11. Juli, versammelt sich die Bildungsgemeinschaft bei der 73. Internationalen Pädagogischen Werktagung in Salzburg. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ wird das gesellschaftlich hochrelevante Thema Inklusion in Pädagogik und Sozialarbeit diskutiert. Wie gelingt ein friedliches Miteinander in zunehmend polarisierten Gesellschaften? Fachleute und Pädagog:innen suchen Antworten – praxisnah und interdisziplinär.
Zwischen Philosophie, Theologie und europäischer Verantwortung
Eine intellektuell dichte Auseinandersetzung bietet auch das Format Disputationes (22.–24. Juli), das im Rahmen der „Ouverture spirituelle“ zur Salzburger Festspielzeit stattfindet. Begriffe wie „Schicksal“, „Vorsehung“ oder „Verhängnis“ werden dort in philosophisch-theologischer Tiefe durchleuchtet – ein Diskursangebot, das weit über den akademischen Tellerrand hinausreicht.
Ein besonderer Akzent im diesjährigen Sommerprogramm setzt die Internationale Sommertagung des Katholischen Akademiker/innenverbands (KAVÖ), die vom 21. bis 24. August im Bildungshaus Sodalitas in Tainach/Tinje stattfindet. Unter dem Leitthema „Europa – in geistigem Umbruch und politischer Neuordnung“ versammelt sich hier ein hochkarätiges Podium, um über die gegenwärtigen Herausforderungen unseres Kontinents nachzudenken: Klimakrise, technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, globale Migration – und nicht zuletzt die Frage nach den geistigen Fundamenten Europas.
Zu den Vortragenden zählen unter anderem die frühere Außenministerin Ursula Plassnik, die Generalsekretärin der Katholischen Aktion Regina Petrik, der renommierte Ethiker Leopold Neuhold sowie Militärbischof Werner Freistetter. Unterschiedliche fachliche und persönliche Perspektiven treffen hier aufeinander und versprechen ein vielschichtiges, inspirierendes Gesprächsklima. Auch diese Tagung lädt dazu ein, den Sommer nicht nur als Zeit des Rückzugs, sondern als bewusste Auseinandersetzung mit den Fragen unserer Zeit zu nutzen – ein Angebot, das Geist, Glaube und Gegenwart auf besondere Weise verbindet.
Spiritualität, Bibel und die Kunst des Glaubens
Wer auf der Suche nach spirituellen Impulsen ist, wird ebenfalls fündig: Die Salzburger Hochschulwoche (4.–10. August) widmet sich unter dem Titel „Was uns leben lässt ... und was uns (vielleicht) vergiftet“ existenziellen Fragen nach dem, was dem Leben Sinn und Halt gibt – oder es ins Wanken bringt. Vorträge und Diskussionen zu Themen wie Einsamkeit, toxischen Theologien oder Spiritualität in Krisenzeiten machen diese Woche zu einem Denkraum zwischen Glauben, Psychologie und Gesellschaft.
Noch dichter an den theologischen Kern führt die Theologische Sommerakademie in Aigen/Mühlkreis (25.–27. August) sowie die Innsbrucker Theologischen Sommertage (1.–2. September). Erstere widmet sich dem Themas "Christus ist Sieger". Behandelt werden das Konzil von Nizäa 325, die Christkönig-Enzyklika (1925) sowie das Heilige Jahr 2025. Die Innsbrucker Theologischen Sommertagestehen ganz im Zeichen des trinitarischen Denkens und fragen danach, was das christliche Glaubensbekenntnis heute bedeuten kann. Das Angebot richtet sich sowohl an theologisch Versierte als auch an Glaubende mit Fragen.
Mit einem biblischen Schwerpunkt beschließt die Bibelpastorale Studientagung in Salzburg (5.–6. September) die Saison. Unter dem Titel „Mirjam und Mose – Wege in die Freiheit“ werden feministische wie klassische Zugänge zur Exodusgeschichte mit praktischen Methoden wie Schreibmeditation und Leitungstraining verknüpft.
Sommer mit Sinn
Wer also nach einer Möglichkeit sucht, den Sommer nicht nur als Auszeit, sondern auch als Einkehr und Aufbruch zu gestalten, findet in den kirchlichen Sommertagungen ein reiches Angebot. Die Veranstaltungen laden dazu ein, sich persönlich, geistig und spirituell neu auszurichten – ob für ein Wochenende oder eine ganze Woche. Ein Sommer der anderen Art – entschleunigt, durchdacht, bereichernd.
Quellen: https://www.theologische-sommerakademie.at/,
https://ku-linz.at/philosophie/veranstaltungen_am_fachbereich_philosophie/veranstaltungen/sommerschule_bioethik_im_kontext_xii_natur_und_normativitaet
https://bildungskirche.at/werktagung/programm
https://www.virgil.at/bildung/veranstaltung/ouverture-spirituelle-25-0945/
https://www.kavoe.at/europa-in-geistigem-umbruch-und-politischer-neuordnung/#more-3111
https://www.salzburger-hochschulwochen.at/&ts=1750766396707
https://www.uibk.ac.at/de/theol/intheso/tagungsarchiv/intheso-2025/
https://www.bibelwerk.at/bibelpastorale-studientagung und Kirchliche Sommertagungen: Bildung, Theologie und spirituelle Impulse
Was feiern Christen zu Pfingsten?
Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des Evangeliums in Gang setzte.
Woher kommt der Name „Pfingsten“?
Der Begriff stammt vom griechischen pentekoste und bedeutet „der Fünfzigste“. Gefeiert wird am 50. Tag nach Ostern.
Was geschah laut Bibel am Pfingsttag?
In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass der Heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen auf die versammelten Jünger kam. Sie begannen, in fremden Sprachen zu sprechen – und alle Menschen verstanden sie.
Warum ist das so bedeutsam?
Das Pfingstwunder zeigt: Der christliche Glaube ist für alle Menschen da, unabhängig von Herkunft, Sprache oder Kultur. Es war der Startpunkt der weltweiten Mission der Kirche.
Wie reagierten die Menschen damals?
Petrus hielt eine eindrucksvolle Predigt. Die Folge: Rund 3.000 Menschen ließen sich taufen. Eine Gemeinschaft entstand – die erste christliche Gemeinde.
Welche Symbole stehen für Pfingsten?
Vor allem zwei: Feuerzungen, als Zeichen der göttlichen Kraft, und die Taube, Sinnbild für den Heiligen Geist – sanft, friedlich, lebensspendend.
Was bedeutet Pfingsten heute?
Es erinnert daran, dass Gott durch den Heiligen Geist heute noch wirkt – in jedem Menschen, der glaubt, hofft und liebt.
Wann genau ist Pfingsten?
Da es vom Osterdatum abhängt, liegt Pfingsten zwischen dem 10. Mai und dem 13. Juni – immer an einem Sonntag, gefolgt vom gesetzlichen Feiertag am Pfingstmontag.
Papst Leo XIV. präsentiert Vision für Dialog, Frieden und synodale Erneuerung
Bei einer Audienz mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Religionen hat Papst Leo XIV. zentrale Linien seines künftigen Pontifikats skizziert. Im Zentrum seiner Ansprache: ein entschiedener Appell zur Zusammenarbeit der Religionen für Frieden und Gerechtigkeit, ein klares Bekenntnis zur Fortsetzung der Weltsynode – und eine offene Hand in Richtung Ökumene und interreligiösem Dialog.
Religionen als Friedensstifter: „Nein zum Krieg, Ja zur Menschlichkeit“
In einer Zeit wachsender internationaler Spannungen und sozialer Polarisierung rief Leo XIV. die Religionen zu einer gemeinsamen, glaubwürdigen Stimme für den Frieden auf. Es sei die Verantwortung aller Glaubensgemeinschaften, deutlich Stellung zu beziehen – gegen Krieg, Wettrüsten und ausbeuterische Wirtschaftsstrukturen.
„Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam – frei von ideologischen und politischen Zwängen – ein wirksames ‚Nein‘ zum Krieg und ein ‚Ja‘ zur Abrüstung und zur ganzheitlichen Entwicklung sagen können“, so der Papst. Religionen hätten der Welt nicht nur spirituelle Antworten zu bieten, sondern auch „Weisheit, Mitgefühl und Engagement für das Wohl der Menschheit und den Schutz unseres gemeinsamen Hauses“.
Synodalität als Zukunftsweg der Kirche
Papst Leo knüpft dabei erkennbar an das Programm seines Vorgängers Franziskus an, insbesondere an dessen Initiative zur Weltsynode, die eine stärkere Beteiligung aller Gläubigen in der Kirche anstrebt.
„Synodalität ist kein Modewort, sondern Ausdruck eines erneuerten Kirchenverständnisses“, betonte Leo. Er sehe es als seine Aufgabe, „konkrete Formen für eine intensivere synodale Praxis im ökumenischen wie auch im kirchlichen Raum zu entwickeln“. Das Miteinander in der Kirche solle auf Dialog, gegenseitigem Hören und Verantwortung aufbauen.
Ökumene: Auf dem Weg zur sichtbaren Einheit
Ein zentrales Anliegen bleibt für Leo XIV. die Ökumene. Als Bischof von Rom, so sagte er, sei es seine „vorrangige Pflicht, auf die Wiederherstellung der vollen und sichtbaren Gemeinschaft“ aller Christinnen und Christen hinzuarbeiten, die sich zu Gott in Vater, Sohn und Heiligem Geist bekennen.
Mit symbolischer Kraft verwies er auf das Erste Ökumenische Konzil von Nizäa, das im Jahr 325 das gemeinsame Glaubensbekenntnis der Christenheit formulierte. Die Einladung von Patriarch Bartholomaios I. zur 1.700-Jahr-Feier in der heutigen Türkei stehe im Raum – eine Teilnahme des Papstes wäre ein starkes Zeichen ökumenischer Verbundenheit. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.
Interreligiöser Dialog: Brücken bauen mit Juden und Muslimen
Leo XIV. bekräftigte darüber hinaus sein persönliches Engagement für den Dialog mit dem Judentum und dem Islam. In Richtung der jüdischen Gemeinschaft sprach er von einer „besonderen Beziehung“, die sich aus den Wurzeln des Christentums im Judentum ableite. Der theologische Dialog sei ihm „ein Herzensanliegen – gerade in einer Zeit, die von Missverständnissen und Spannungen geprägt ist“.
Auch die Beziehungen zum Islam hob der Papst hervor. Er würdigte die Fortschritte im interreligiösen Austausch, die insbesondere auf dem Dokument zur Geschwisterlichkeit aller Menschen beruhen, das Franziskus 2019 gemeinsam mit dem Großimam von al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, in Abu Dhabi unterzeichnet hatte. „Ein respektvoller Dialog, gegründet auf Gewissensfreiheit, ist der Schlüssel für echte Geschwisterlichkeit zwischen unseren Gemeinschaften“, so Leo.
Ein Papst des Dialogs – mit eigener Handschrift
Mit dieser programmatischen Ansprache deutet sich an, wohin Papst Leo XIV. die katholische Kirche führen will: nicht als monolithische Institution, sondern als geistlich geeinte und menschlich offene Gemeinschaft. Seine Worte wirken wie ein Nachhall der Linie Franziskus’ – doch mit einer eigenen, klaren Akzentuierung: Synodalität als Kultur, Dialog als Methode, Frieden als Ziel.
Quelle: kathpress. redigiert durch ÖA
Wenn Glocken verstummen und Kerzen die Dunkelheit durchbrechen, dann beginnt für Christinnen und Christen eine der tiefgründigsten Zeiten des Jahres: das Triduum Sacrum.
Drei Tage, die keine gewöhnlichen Feiertage sind, sondern als Einheit ein einziges großes Hochfest bilden. Sie erzählen vom letzten Abendmahl, vom Sterben am Kreuz und vom überwältigenden Wunder der Auferstehung. Vom Gründonnerstagabend bis zur Vesper des Ostersonntags spannt sich ein geistlicher Bogen, der in einzigartiger Dichte Leben, Tod und neues Leben zusammenführt – eine Einladung zur Besinnung, zum Innehalten und zum Staunen.
Gründonnerstag
Im Zentrum des Gründonnerstags steht das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern – ein Moment tiefster Gemeinschaft und zugleich Beginn des Leidenswegs. Die Kirche erkennt in dieser Abendmahlsfeier die Einsetzung der Eucharistie – jenes zentralen Elements der Heiligen Messe, das bis heute Herzstück jedes Gottesdienstes ist. Das letzte Abendmahl weist dabei über sich hinaus – hin zum himmlischen Freudenmahl, das im Glauben als Ziel und Hoffnung aller Gläubigen verankert ist.
Hintergrund
19. April, um 2100 Uhr Osternacht mit Erwachsenentaufe mit Militärbischof Werner FREISTETTER in der St. Georgskathedrale zu Wiener Neustadt
Ein Zögling der Bundeshandelsakademie Wiener Neustadt wird im Zuge des Festgottesdienstes getauft. Dieser Taufe ging die Salbung mit demDie biblischen Überlieferungen berichten von einem festlichen Mahl Jesu in Jerusalem, dem sich bedeutungsvolle Gesten und Ereignisse anschließen: die Fußwaschung als Zeichen dienender Liebe, das Gebet am Ölberg, das Ringen im Angesicht des nahenden Todes – und schließlich die nächtliche Gefangennahme.
Der Name "Gründonnerstag" leitet sich wohl vom mittelhochdeutschen gronan – weinen – ab, da an diesem Tag reuige Büßer wieder in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen wurden. Eine andere Deutung verweist auf grüne Messgewänder, die im Mittelalter an diesem Tag getragen wurden.
Form der Feier und Brauchtum
Die Liturgie des Gründonnerstags erinnert unmittelbar an das letzte Abendmahl: Die Fußwaschung wird symbolisch durch den Priester vollzogen – ein demütiges Zeichen der Liebe und Hingabe. Nach dem feierlichen Gottesdienst schweigen Glocken und Orgeln bis zur Osternacht – im Volksglauben „fliegen sie nach Rom“.
Das heilige Brot wird ehrfurchtsvoll zu einem Seitenaltar getragen, während der Hauptaltar leergeräumt wird – ein Ausdruck der wachsenden Dunkelheit, die sich über die kommenden Tage legt. In manchen Gemeinden werden kleine, gesegnete Brote verteilt – ein greifbares Zeichen der Gemeinschaft.
Donnerstag, 17. April, 1800 Uhr - Gründonnerstagsliturgie mit Militärbischof Werner Freistetter in der St. Georgs-Kathedrale in Wiener Neustadt
Karfreitag
Am Karfreitag richtet sich der Blick auf das Kreuz – das Symbol des Leidens, aber auch des tiefsten Vertrauens. Es ist der Tag, an dem Christinnen und Christen des Sterbens Jesu gedenken, der – so der Glaube – für die Erlösung der Menschheit den Tod auf sich nahm.
Hintergrund
Die biblischen Berichte zeichnen ein eindrückliches Bild: von der Gefangennahme Jesu über das Verhör vor Pontius Pilatus bis hin zur Kreuzigung auf Golgota, vollzogen zur neunten Stunde – um 15 Uhr. Es ist ein Tag der Stille, des Schmerzes und der Ehrfurcht.
Form der Feier
Um die Todesstunde Jesu versammeln sich vielerorts Gläubige zu Kreuzwegandachten. Am Abend lädt ein Wortgottesdienst zur stillen Besinnung und zur Kreuzverehrung ein. Der Karfreitag ist zudem ein strenger Fasttag – Ausdruck der Anteilnahme am Leid Christi und Zeichen geistiger Vorbereitung auf das Osterfest.
18. April, 1800 Uhr - Karfreitagsliturgie mit Militärbischof Werner Freistetter in der St. Georgs-Kathedrale in Wiener Neustadt
Karsamstag
Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe – eine Zeit des Schweigens, der Trauer und der Erwartung. Die Kirche verharrt in stiller Andacht. Kein Gottesdienst wird gefeiert, keine Kommunion gespendet. Alles verweilt in einem Zustand des Dazwischen – zwischen Tod und Leben, zwischen Dunkelheit und aufkeimender Hoffnung.
Osterfest / Osternachtsfeier
Mit der Osternacht beginnt das Fest aller Feste: Ostern. In der Dunkelheit des Karsamstags flammt neues Licht auf – Symbol für Christi Auferstehung und die Überwindung des Todes. Diese Nacht verkündet das Herz der christlichen Botschaft: das Leben siegt.
19. April, 2100 Uhr - Osternacht mit Erwachsenentaufe mit Militärbischof Werner Freistetter in der St. Georgs-Kathedrale in Wiener Neustadt
20. April, 1000 Uhr - Ostersonntagsmesse mit Militärbischof Werner Freistetter in der St. Georgs-Kathedrale in Wiener Neustadt
Hintergrund
Ostern wurzelt im jüdischen Paschafest, das Jesus mit seinen Jüngern feierte. Seine Kreuzigung und Auferstehung geschahen rund um dieses Fest, das den Auszug Israels aus der Sklaverei Ägyptens erinnert – eine symbolträchtige Verbindung.
Die Evangelien berichten von unterschiedlichen Erscheinungen des Auferstandenen – in Jerusalem oder in Galiläa, bei einem Mahl oder auf dem Weg. Nicht die historische Beweisbarkeit steht im Zentrum, sondern die tiefen Glaubenserfahrungen der Jünger, die Christus in neuer Weise begegneten.
Form der Feier und Brauchtum
Die Feier der Osternacht beginnt in der Dunkelheit – Sinnbild für Tod und Hoffnungslosigkeit. Vor der Kirche wird ein Feuer entfacht, an dem die große Osterkerze entzündet wird. Mit ihr zieht der Priester in die dunkle Kirche ein und ruft dreimal: „Lumen Christi“ – das Licht Christi. Die Gemeinde antwortet mit „Deo gratias“ – Dank sei Gott.
Nach und nach erhellt sich der Raum, während das Licht von Kerze zu Kerze weitergegeben wird. Der anschließende Wortgottesdienst erzählt die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen – von der Schöpfung bis zur Erlösung.
Im Zentrum steht die Eucharistiefeier, in der erstmals seit dem Gründonnerstag das heilige Brot wieder gewandelt wird – Christus wird mitten in der Gemeinde gegenwärtig. Nach der Messe versammeln sich viele Gläubige am Osterfeuer, teilen Brot oder wärmen sich im Licht der Hoffnung.
Mancherorts wird der „Osterlauf“ veranstaltet – eine lebendige Erinnerung an die Jünger, die am Ostermorgen voller Aufregung zum leeren Grab eilten.
Auch bekannte Osterbräuche wie das Osterei oder der Osterhase haben tiefe symbolische Wurzeln: Das Ei – Sinnbild für neues Leben und Fruchtbarkeit – wurde früher als Naturalzins entrichtet. Der Hase, der mit offenen Augen schläft, wurde in der byzantinischen Symbolik als Bild für Christus gesehen, der im Tod nicht schläft, sondern lebt.
Das Triduum Sacrum lädt dazu ein, die zentralen Geheimnisse des Glaubens nicht nur zu erinnern, sondern innerlich mitzuvollziehen. Zwischen Brot und Kreuz, Feuer und Licht, Trauer und Jubel entfaltet sich ein Weg, der vom Dunkel ins Licht führt – ein Weg, der bis heute Kraft und Orientierung zu schenken vermag.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Die 8. Station des Kreuzwegs – Jesus begegnet den weinenden Frauen
Auf dem staubigen, steinigen Weg zur Schädelstätte, wo das Kreuz bereits wartet, bricht für einen Moment der Strom der Ereignisse auf. Jesus bleibt stehen. In der Masse, die seinen Leidensweg säumt, nimmt er sie wahr – eine Gruppe von Frauen, deren Gesichter von Tränen gezeichnet sind. Sie beweinen nicht nur das, was ihnen vor Augen liegt – einen geschundenen Mann auf dem Weg zur Hinrichtung – sondern auch das, was sie in ihrem Herzen spüren: dass hier Unrecht geschieht. Tiefes Unrecht. Denn dieser Jesus war kein Aufrührer, kein Gewalttäter, sondern einer, der das Leben heilte, der Trost brachte, der das Gebot der Liebe zur Lebensform gemacht hatte.
Doch Jesus, selbst in seinem Leid nicht um sich selbst kreisend, richtet das Wort an sie – und durch sie hindurch an die Welt:
„Töchter Jerusalems, weint nicht über mich; weint vielmehr über euch und eure Kinder!“
(Lukas 23,28)
Es ist ein Riss in der Szene. Die Worte treffen wie Donner in eine stille Landschaft. Der Mann, der hier alles verliert, spricht nicht über sein eigenes Leid – sondern über das Leid, das kommen wird. Ein prophetisches Bild, dunkel und eindringlich: Berge, unter die man sich wünscht, um dem Grauen zu entgehen; Zeiten, in denen Unfruchtbarkeit zum Segen wird, weil Kinder in eine Welt geboren würden, die keine Gnade kennt. Jesu Blick reicht über das unmittelbare Drama hinaus. Er sieht das, was dieses Leiden offenbart: Eine Menschheit, die die Liebe verwirft, die Angst zur Politik macht und Gewalt als Lösung akzeptiert. Und er sieht, dass es immer wieder die Verwundbarsten sind – Frauen, Kinder, die Unschuldigen – die unter die Räder geraten.
Die weinenden Frauen stehen für jene seltenen, aber wichtigen Stimmen in der Gesellschaft, die Unrecht erkennen, wenn es geschieht. Doch selbst ihr Mitgefühl bleibt gefährlich nah am Offensichtlichen. Jesus aber fordert den tieferen Blick: Nicht Mitleid für ihn, sondern Erkenntnis des eigenen Verstrickens. Eine Mahnung: Wo das „grüne Holz“ – das Leben selbst – zerstört wird, was wird dann mit dem „dürren Holz“, mit der verwundbaren Menschheit, geschehen?
Ein Moment zum Innehalten:
Wer sind heute die „weinenden Frauen von Jerusalem“?
Welche Ereignisse rühren uns emotional – und wo bleiben wir doch an der Oberfläche?
Wo ist mein Platz in einer Welt, die die Liebe Gottes oft zurückweist?
Kann ich den Mut finden, nicht nur zu trauern, sondern zu erkennen und zu handeln?
Jesus bleibt stehen. Auch wir dürfen stehen bleiben. Für einen Moment. Und hinhören.
Wenn der Frühling erwacht und die Natur in leiser Schönheit erblüht, beginnt für Millionen Gläubige weltweit die tief bewegende Zeit der Karwoche – eine Woche der Einkehr, der Erinnerung und der Hoffnung. In stillen Riten und symbolreichen Bräuchen verdichten sich Schmerz, Liebe und Triumph zu einer dramatischen Liturgie, die in der Auferstehung Christi gipfelt.
Vom Einzug in Jerusalem zur Auferstehung – Die Tage der Karwoche
Die Karwoche, auch „Stille Woche“ genannt, umfasst die letzten sieben Tage vor Ostern. Sie beginnt mit dem Palmsonntag, an dem die Christen den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem feiern – ein scheinbarer Beginn des Sieges, der sich bald in das Dunkel von Verrat, Leiden und Tod wandelt.
Montag bis Mittwoch gelten als stille Tage, getragen von der Vorahnung des Kommenden. Es sind Tage des Rückzugs, der Vorbereitung – eine innere Passionszeit.
Am Gründonnerstag beginnt das sogenannte Triduum Sacrum, die „Heiligen Drei Tage“. Hier erinnert die Kirche an das Letzte Abendmahl, an Jesu Fußwaschung als radikalen Ausdruck der Demut und an die beginnende Passion.
Der Karfreitag markiert den tiefsten Punkt der liturgischen Erzählung: Jesu Kreuzestod. Es ist ein Tag der strengen Stille, des Fastens und der Trauer. Glocken schweigen, stattdessen erklingen hölzerne Ratschen – ein Klang wie aus einer anderen Zeit.
Karsamstag, der Tag der Grabesruhe, steht im Zeichen der Erwartung. Erst mit der Feier der Osternacht, wenn das Osterfeuer entzündet und die Osterkerze entzündet wird, kehrt Licht zurück – Symbol für das durch die Auferstehung überwundene Dunkel.
Ein Erbe aus Trauer und Hoffnung
Der Begriff „Karwoche“ stammt vom althochdeutschen kara – Kummer, Klage, Trauer. Doch diese Woche erschöpft sich nicht in Wehklagen. In ihrem Zentrum steht die Botschaft, dass nach dem Leid das Leben kommt, nach der Finsternis das Licht. Diese dialektische Tiefe macht sie zur spirituell reichsten Zeit des Jahres. In der katholischen Tradition wird diese Zeit auch als „Heilige Woche“ bezeichnet – weniger als Trauerwoche, sondern als heiliger Spannungsbogen zwischen Tod und Leben.
Rituale und Bräuche – gelebte Erinnerung
Die Karwoche ist nicht nur ein liturgischer Ablauf, sondern ein tief verwurzeltes kulturelles und religiöses Erbe, das in vielen Regionen lebendig bleibt.
Am Palmsonntag etwa ziehen Gläubige mit geweihten Zweigen in Prozessionen durch die Straßen – eine Reminiszenz an die jubelnde Menge in Jerusalem. In Süddeutschland und Österreich versüßt man sich diesen Tag mit der traditionellen Palmbrezel, einem gehaltvollen Fastengebäck aus Hefeteig.
Der Gründonnerstag wird begleitet von der symbolträchtigen Fußwaschung, bei der Geistliche zwölf Menschen die Füße waschen – ein sichtbares Zeichen christlicher Demut. Während des Gloria der Messe erklingen zum letzten Mal die Glocken – dann schweigen sie bis zur Osternacht. Der Volksglaube erzählt, sie seien „nach Rom geflogen“.
Am Karfreitag, einem der strengsten Fasttage des Kirchenjahres, versammelt sich die Gemeinde zur Kreuzverehrung, oft zur Todesstunde Jesu um 15 Uhr. Viele Familien essen an diesem Tag Fisch – ein uraltes christliches Symbol und traditionelles Gericht, das die fleischlose Askese begleitet.
Ostern – Das Herz des Glaubens
Am Ende dieser dichten Woche steht das zentrale Fest der Christenheit: Ostern. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wird mit dem Licht der Osterkerze, dem Wasser der Tauferneuerung und dem feierlichen Halleluja der Sieg des Lebens über den Tod verkündet.
Ostern ist ein bewegliches Fest, das sich nach dem Frühlingsvollmond richtet. 2025 fällt es auf den 20. April – und markiert eine seltene Übereinstimmung aller christlichen Konfessionen. Ein gemeinsames Ostern, das viele als Symbol für die Einheit der Christen sehen.
Eine stille Woche, die laut spricht
Die Karwoche ist keine bloße historische Rückschau, sondern eine existentielle Erzählung, die jedes Jahr neu erlebt wird – in stillen Kirchen, im Klang der Ratschen, im Licht der Osterkerze. Sie erinnert uns daran, dass die tiefsten Wahrheiten des Lebens oft im Schweigen wohnen. Und dass aus der Trauer Hoffnung wächst. Denn das Herz der Karwoche schlägt für eine Botschaft, die weit über die religiöse Dimension hinausreicht: Dass am Ende das Leben siegt – über Leid, über Zweifel, über den Tod.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Konkrete Entscheidungen rücken in den Fokus
Im Vatikan läuft seit dem 2. Oktober 2024 die zweite Vollversammlung der Weltsynode der katholischen Kirche. Rund 370 Teilnehmer, darunter 320 Männer und 50 Frauen, diskutieren über die Zukunft der Kirche. Während die Beratungen im vergangenen Jahr eher allgemein blieben, scheint der Ton nun fokussierter zu sein. "Man kommt schneller auf den Punkt", fasst eine Synodenteilnehmerin den Wandel zusammen. Doch die zentrale Frage bleibt: Werden diesmal konkrete Beschlüsse gefasst?
Keine Parlamentsdebatten, aber Fokus auf brennende Themen
Der Ablauf der Sitzungen unterscheidet sich deutlich von klassischen Parlamentsdebatten. Fünf Redner tragen ihre Positionen vor, anschließend wird meditiert, bevor die Diskussion fortgesetzt wird. Thematische Schwerpunkte entstehen oft durch gut abgestimmte Redebeiträge, die die Dringlichkeit bestimmter Fragen unterstreichen. Besonders im Fokus stehen die Rolle der Frau in der Kirche und der Umgang mit sexuellen Minderheiten. Auch die Beteiligung der Gläubigen an Entscheidungsprozessen ist ein zentrales Thema der Synode.
An den Tischen, an denen die Synodalen in ihren jeweiligen Sprachgruppen diskutieren, geht es dagegen oft lebhafter zu. Hier wird nicht nur zugehört, sondern auch „sehr deutlich“ erwidert, wie Teilnehmer berichten. Allerdings bringt die sprachliche Vielfalt auch Herausforderungen mit sich, insbesondere für deutschsprachige Teilnehmer, da Deutsch keine offizielle Konferenzsprache mehr im Vatikan ist.
Sprachliche und kulturelle Barrieren
Für einige deutschsprachige Synodale stellt die Sprache ein erhebliches Hindernis dar. Wer weder Italienisch noch Spanisch spricht, hat es schwer, Gehör zu finden – insbesondere beim Papst. Franziskus, der selbst nur selten der Simultanübersetzung lauscht, versteht vor allem Redebeiträge in seinen Muttersprachen Spanisch und Italienisch. Dennoch bemüht sich das polyglotte Synodensekretariat, die Vielfalt der eingereichten Ideen zu berücksichtigen.
Auch kulturelle Unterschiede spielen eine Rolle bei der Bildung von Gruppen innerhalb der Synode. Während konservative Teilnehmer aus Osteuropa in der Vergangenheit oft ablehnend gegenüber liberaleren Meinungen auftraten, zeigen sie sich dieses Jahr überraschend offen. Der Umgang mit den als „ultraliberal“ bezeichneten deutschen Vertretern ist deutlich entspannter.
Selbstbewusste Stimmen aus Afrika
Besonders auffällig ist der selbstbewusste Auftritt der afrikanischen Bischöfe. Sie hatten Ende 2023 mit ihrem Widerstand gegen das Segnungspapier „Fiducia supplicans“, das homosexuellen Paaren die Segnung ermöglichte, für Aufsehen gesorgt. Auch wenn nicht alle Synodalen diesen konservativen Standpunkt teilen, wird den Afrikanern in Verfahrensfragen Recht gegeben. So verweigerten sie dem Glaubenspräfekten Kardinal Fernandez, der gegen die Zulassung von Frauen zu Diakonatsämtern ist, ihre Unterstützung.
Am 18. Oktober soll eine neue Aussprache zu diesen und weiteren kontroversen Themen stattfinden. Arbeitsgruppen, die sich mit zehn spezifischen Fragen wie dem Zölibat und der Rolle der Frau in der Kirche beschäftigen, werden den Synodalen Rede und Antwort stehen.
Die Herausforderung der Mitbestimmung
Viele Teilnehmer der Synode fordern bereits jetzt, dass auch bei der Endversammlung im Juni 2025 eine ähnliche Debatte stattfinden muss. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse direkt dem Papst vorlegen. Doch Papst Franziskus hat mit seinem Appell zu „mehr Synodalität“ eine Dynamik angestoßen, die nun schwer zu stoppen scheint.
„Es ist bemerkenswert, dass ein Papst wie Franziskus, der eher zu einsamen Entscheidungen neigt, das Prinzip der Mitbestimmung vorangetrieben hat und es nun nicht mehr aufhalten kann“, so ein Synodenteilnehmer. Wie sich der Papst dabei fühlt, bleibt offen. Fest steht jedoch, dass er im Plenum seltener das Wort ergriffen hat als noch im Vorjahr.
Fazit: Der Weg zu Reformen ist noch unklar
Die Weltsynode im Vatikan hat klare Forderungen nach mehr Transparenz und Mitbestimmung auf den Tisch gebracht. Doch der Weg zu konkreten Reformen ist kompliziert und von kulturellen, sprachlichen und politischen Spannungen geprägt. Ob die Synodalen es schaffen, im Sinne der Gläubigen wegweisende Entscheidungen zu treffen, wird sich zeigen, wenn am 26. Oktober die endgültigen Vorschläge formuliert werden. Bis dahin bleibt vieles im Unklaren – doch der Druck auf die Kirche wächst.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Eucharistie und die verwundete Welt: Globale Herausforderungen im Fokus
Unter dem Motto "Geschwisterlichkeit zur Rettung der Welt" versammeln sich in dieser Woche über 6.000 Teilnehmer aus 53 Ländern in Quito, Ecuador, zum 53. Eucharistischen Weltkongress. Bei diesem bedeutenden katholischen Großereignis, das alle vier Jahre stattfindet, werden drängende globale Fragen wie Klimawandel, Kriege, Korruption und Armut aus religiöser Perspektive beleuchtet.
Bereits an den ersten beiden Kongresstagen, Montag und Dienstag, widmeten sich Vorträge dem Thema "verwundete Welt". Der spanische Filmemacher Juan Manuel Cotelo eröffnete den Kongress mit eindrücklichen Worten über die Bedeutung der Nächstenliebe und Vergebung. Er sprach davon, dass Jesus die Welt nicht verurteile, sondern rette, und betonte, wie wichtig es sei, „die rettende Quelle des Evangeliums und der Eucharistie“ in die verwundete Welt zu tragen. Cotelo erinnerte daran, dass der „Kleinste der Mächtigste“ sei und die Überwindung von Egoismus der Schlüssel zu einem friedlichen Zusammenleben darstelle.
Umweltkrise und Klimawandel: Ein Aufruf zur Verantwortung
Die ökologische Krise und der Klimawandel standen ebenfalls im Mittelpunkt der Diskussionen. Der brasilianische Erzbischof Jaime Spengler, Präsident des Lateinamerikanischen Bischofsrates, verwies auf die enge Verbindung zwischen dem christlichen Glauben und der Verantwortung für die Schöpfung. Der Verlust der Heiligkeit der Natur sei ein Grund für die aktuelle Umweltkrise. Spengler betonte, dass die Eucharistie keine Distanz zur Welt schaffe, sondern vielmehr Gemeinschaft und Verantwortung fördere.
Gesellschaftliche Wunden: Korruption und Ungerechtigkeit
Rodrigo Guerra, Sekretär der Päpstlichen Lateinamerika-Kommission, und Quitos Bürgermeister Pabel Muñoz sprachen über die „gesellschaftlichen Wunden“, die besonders in lateinamerikanischen Städten sichtbar sind. Themen wie Korruption, Konsumismus und soziales Unrecht wurden aus der Perspektive des christlichen Glaubens beleuchtet. Beide Redner hoben die Kraft des Glaubens hervor, Herzen und Realitäten zu verändern, indem man sich an Geschwisterlichkeit und Menschlichkeit orientiere.
Der Krieg in der Ukraine: Eucharistie als Quelle der Widerstandskraft
Auch der Krieg in der Ukraine fand auf dem Weltkongress Gehör. Weihbischof Hryhorij Komar aus der Ukraine betonte die spirituelle Stärke seines Landes und erklärte, dass die Widerstandsfähigkeit gegen die russische Invasion aus der Einheit mit Gott und der Eucharistie stamme. Der Bischof rief die Anwesenden eindringlich dazu auf, für die Ukraine zu beten und hob die heilende Kraft des Glaubens in Zeiten des Krieges hervor.
Revolution der Zärtlichkeit: Eine Theologie der Umkehr
Die argentinische Theologin Sr. Daniela Cannavina sprach in ihrem Vortrag über die „Revolution der Zärtlichkeit“, die von der Eucharistie ausgehe. Die Begegnung mit Jesus in der Heiligen Kommunion führe zu einer Umkehr hin zu universeller Geschwisterlichkeit. Diese Transformation verwandle Macht in Dankbarkeit und Gleichgültigkeit in Solidarität. Ihre Worte zeichneten ein Bild der Hoffnung, dass die Welt durch die Liebe Gottes geheilt werden könne.
Persönliche Glaubenszeugnisse: Schicksale, die Hoffnung spenden
Neben theologischen Vorträgen bot der Kongress auch Raum für persönliche Glaubenszeugnisse. Margaret Fellker aus den USA berichtete von ihrem Sohn David, der 2002 in Ecuador verschwand. Die tragische Suche nach ihrem Sohn verwandelte sich in eine Mission der Nächstenliebe. Mit ihrem Mann gründete sie das Hilfswerk „David's Educational Opportunity Fund“, das benachteiligten Jugendlichen in Ecuador Bildungschancen bietet.
Ein globales Großereignis: Begegnung im Zeichen der Eucharistie
Der Eucharistische Weltkongress zählt neben den Weltjugendtagen zu den größten katholischen Veranstaltungen weltweit. Seit 1881 finden diese Kongresse an wechselnden Orten statt, um die zentrale Bedeutung der Eucharistie in der katholischen Kirche zu stärken. Der diesjährige Veranstaltungsort Quito wurde von Papst Franziskus anlässlich des 150. Jahrestages der Herz-Jesu-Weihe der Stadt ausgewählt.
Eröffnet wurde der Kongress am Sonntag mit einer festlichen Messe, an der 40.000 Gläubige teilnahmen. In den kommenden Tagen werden unter anderem Vorträge über das „Heiligste Herz Jesu“ und die Bedeutung der Eucharistie gehalten. Den Höhepunkt bildet eine feierliche Messe mit anschließender Prozession am Samstag durch Quitos historische Altstadt.
Mit der Bekanntgabe des Austragungsortes des nächsten Kongresses im Jahr 2028 endet das Großereignis am Sonntag feierlich.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Ein Fest mit tiefer Bedeutung
Das Pfingstfest, ein Fest, das an ein bemerkenswertes Ereignis aus biblischen Zeiten erinnert – die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu. Pfingsten, ein fester Bestandteil des christlichen Kalenders, bietet eine Gelegenheit, die Vergangenheit zu reflektieren und die Bedeutung des Heiligen Geistes in der heutigen Zeit zu würdigen.
Das Pfingstwunder in Jerusalem
Jerusalem, 1. Jahrhundert: Die Jünger Jesu hatten sich nach dem Tod und der Auferstehung ihres Meisters versammelt. Plötzlich erfüllte ein stürmischer Wind den Raum, und die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dieses "Pfingstwunder" ermöglichte es ihnen, in verschiedenen Sprachen zu sprechen und die Botschaft des Evangeliums in die Welt hinauszutragen. „Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab” (Apg 2,4).
Die Geburtsstunde der Kirche
Das Pfingstereignis hatte eine transformative Wirkung auf die Jünger. Befreit von Furcht, erlangten sie Mut und begannen ihre Mission als Verbreiter des christlichen Glaubens. Dieser Moment gilt als die "Geburtsstunde der Kirche", da die Jünger zum ersten Mal mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet waren.
Pfingsten in der Kunst
Im Laufe der Jahrhunderte hat Pfingsten eine tiefe Präsenz in der Kunst gefunden. Viele Gemälde, Skulpturen und Darstellungen zeigen die Szene der Ausgießung des Heiligen Geistes, oft in Form einer Taube, die über den Jüngern schwebt. Dieses Symbol der Taube steht für den Heiligen Geist und verdeutlicht den göttlichen "Einfluss", den göttlichen "Beistand", der in jenem Moment auf die Jünger zukam und diesen geschenkt wurde.
Pfingsten in der heutigen Liturgie
Auch in der heutigen Liturgie nimmt Pfingsten einen wichtigen Platz ein. Christliche Gemeinden weltweit feiern den Geist von Pfingsten mit besonderen Gottesdiensten und Gebeten. Die Farbe Rot dominiert den liturgischen Raum, symbolisiert sie doch das Feuer und die Leidenschaft des Heiligen Geistes. Gläubige beten um Erneuerung, Inspiration und Stärkung durch die Kraft des Geistes.
Die zeitlose Botschaft von Pfingsten
Pfingsten hat eine zeitlose Botschaft für die Gläubigen von heute. Es erinnert uns daran, dass der Heilige Geist eine Quelle der Führung, des Trostes und der Inspiration ist. Wie die Jünger damals, können auch wir heute die Gaben des Heiligen Geistes nutzen, um unseren Glauben zu stärken und anderen Menschen Gottes Liebe zu zeigen.
Empfehlungen
Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen
„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen
„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen
Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen
Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen
13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen
66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen
24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen
Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen
Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen
65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen
Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen
Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen
Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen
"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen
HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen
Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen
Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen
Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen
Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen
Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen
Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen
Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen
Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen
Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen
Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen
Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen
Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen
Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen
Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen
Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen
25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen