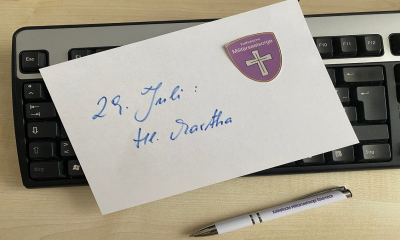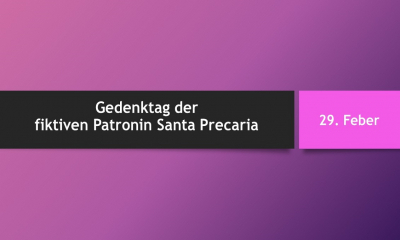Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Wissenswertes rund ums Kirchenjahr (7)
Ein Tag der Besinnung und Umkehr
Mit dem Aschermittwoch beginnt für Christen weltweit eine besondere Zeit: die 40-tägige Fastenzeit, die auf das höchste Fest des Christentums, Ostern, vorbereitet. Geprägt von innerer Einkehr, Buße und Verzicht, erinnert dieser Tag an die Vergänglichkeit des Lebens und lädt zur Besinnung ein. Doch woher stammt diese Tradition, und welche Rituale prägen diesen besonderen Mittwoch?
Ursprung und Bedeutung
Bereits seit dem 6. Jahrhundert ist der Aschermittwoch als jener Mittwoch bekannt, der vor dem sechsten Sonntag vor Ostern liegt. Er markiert den Auftakt einer Zeit der Entsagung und spirituellen Vorbereitung auf das Osterfest. Die Zahl 40 ist hierbei von besonderer Symbolkraft – sie erinnert an die 40 Tage, die Jesus fastend in der Wüste verbrachte.
Der Name "Aschermittwoch" geht auf einen alten kirchlichen Brauch zurück: In der frühen Kirche wurden Büßer an diesem Tag mit Asche bestreut – ein Zeichen der Vergänglichkeit und der Reue. Seit dem 10. Jahrhundert ist zudem die Segnung und Auflegung eines Aschenkreuzes überliefert. Die Asche, gewonnen aus den Palmzweigen des Vorjahres, dient als Zeichen der Buße und der Erneuerung der Seele.
Das Aschenkreuz – Symbol für Umkehr und Neubeginn
Die Zeremonie des Aschenkreuzes ist bis heute ein zentraler Bestandteil des Aschermittwochs. Der Priester zeichnet den Gläubigen ein Kreuz aus Asche auf die Stirn oder streut sie über das Haupt, während er die Worte spricht: „Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst“ (Genesis 3,19). Diese Geste ruft zur Demut auf und erinnert an die Vergänglichkeit des Lebens. Alternativ kann auch der Ruf zur Umkehr ausgesprochen werden: "Kehre um und glaube an das Evangelium." Das Aschenkreuz ist damit auch die Einladung zu einem Neubeginn: eine bewusste Hinwendung zu Gott, ein Leben in Umkehr und Besinnung.
Auch in den katholischen Militärpfarren besteht die Möglichkeit, das Aschenkreuz am Aschermittwoch zu empfangen. So wird auch in diesem besonderen Umfeld die Einladung zur Besinnung und Umkehr erlebbar gemacht.
Fastenzeit: Eine Zeit der inneren Reinigung
Die Fastenzeit, die mit dem Aschermittwoch beginnt, ist für viele Gläubige eine Zeit des bewussten Verzichts. Traditionell bedeutet dies den Verzicht auf Fleisch oder andere Genussmittel, doch in der heutigen Zeit nehmen viele Menschen diese Phase auch zum Anlass, digitale Medien zu reduzieren, achtsamer zu leben oder sich intensiv mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen.
Neben dem individuellen Fasten stehen in dieser Zeit auch Gebet und Nächstenliebe im Mittelpunkt. Die Kirche lädt dazu ein, innezuhalten, sich selbst zu hinterfragen und spirituell zu wachsen.
Ein bewegendes Ritual mit zeitloser Bedeutung
Der Aschermittwoch ist weit mehr als nur der Abschluss der Faschingszeit. Er ist eine Mahnung zur Bescheidenheit, eine Einladung zur Umkehr und eine Gelegenheit zur inneren Reinigung. In einer Welt, die oft von Hektik und Oberflächlichkeit geprägt ist, erinnert er daran, dass das Wesentliche nicht im äußeren Glanz liegt, sondern in der Tiefe des eigenen Herzens.
Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und markiert den Beginn des Kirchenjahres. Er ist voller Symbolik, Traditionen und Rituale, die sowohl spirituell als auch kulturell tief verwurzelt sind.
Wann beginnt und endet der Advent?
Der Advent beginnt immer am vierten Sonntag vor Weihnachten, dem sogenannten ersten Adventssonntag, und endet am Heiligen Abend, dem 24. Dezember. Die Dauer variiert daher zwischen 22 und 28 Tagen, je nachdem, auf welchen Wochentag Weihnachten fällt.
Die Bedeutung der Farben im Advent
In der Liturgie spielt die Farbe Violett eine zentrale Rolle. Sie steht für Buße, Umkehr und Vorbereitung, was den besinnlichen Charakter der Adventszeit unterstreicht. Am dritten Adventssonntag (Gaudete-Sonntag) darf allerdings Rosa verwendet werden – ein Zeichen der Vorfreude auf Weihnachten.
Die Besonderheit der Rorate-Messe
Die Rorate-Messe ist eine stimmungsvolle Tradition des Advents. Sie wird frühmorgens in der Dunkelheit gefeiert, nur erleuchtet von Kerzenlicht. Der Name leitet sich von der lateinischen Antiphon "Rorate caeli desuper" („Tauet, ihr Himmel, von oben“) ab, die die Sehnsucht nach dem Erlöser ausdrückt.
Brauchtum rund um den Advent
Adventskranz: Der Kranz aus immergrünen Zweigen mit vier Kerzen symbolisiert Ewigkeit und Hoffnung. Jeden Adventssonntag wird eine weitere Kerze entzündet, bis schließlich alle vier brennen.
Adventskalender: Ursprünglich eingeführt, um Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen, ist er heute aus keinem Haushalt mehr wegzudenken.
Backen und Basteln: Plätzchenbacken, das Schmücken der Wohnung und das Basteln von Adventsdekoration sind beliebte Traditionen, die Gemeinschaft und Vorfreude fördern.
Nikolausfest: Am 6. Dezember wird das Fest des heiligen Nikolaus gefeiert, das vor allem für Kinder ein Highlight der Adventszeit darstellt.
Die Botschaft des Advents
Der Advent ist nicht nur eine Zeit des Wartens, sondern auch eine Zeit der Besinnung und Umkehr. Die zunehmende Helligkeit durch die Kerzen des Adventskranzes symbolisiert das Kommen Jesu, des „Lichts der Welt“. Auch in der modernen Gesellschaft lädt diese Zeit dazu ein, innezuhalten, Gemeinschaft zu pflegen und den wahren Sinn von Weihnachten zu entdecken.
Fazit
Der Advent vereint spirituelle Vorbereitung mit tief verwurzeltem Brauchtum. Er ist eine Zeit der Hoffnung, der Vorfreude und des Lichts, das in die Dunkelheit strahlt – ein wichtiger Anker im christlichen Jahreslauf und darüber hinaus.
Eine Frau von starkem Glauben
Martha von Betanien ist eine bedeutende Figur im Christentum. Bekannt als eine der ersten Jüngerinnen Jesu, ist sie eine zentrale Figur in mehreren Evangelien. Martha, die Schwester von Maria und Lazarus, lebte im Dorf Betanien, nahe Jerusalem. Sie wird in den Evangelien als fleißige und gewissenhafte Frau beschrieben, die Jesus mehrfach in ihrem Haus bewirtete.
Eine der bekanntesten Episoden mit Martha wird im Lukasevangelium geschildert: Während Martha sich um die Bewirtung Jesu kümmerte, saß ihre Schwester Maria zu Jesu Füßen und hörte ihm zu. Martha beschwerte sich bei Jesus, doch er wies sie darauf hin, dass Maria das Bessere gewählt habe, indem sie auf sein Wort hörte. Diese Geschichte hebt die Bedeutung des Hörens auf das Wort Gottes hervor und betont, dass spirituelle Nahrung genauso wichtig ist wie physische.
Das Glaubensbekenntnis der Martha
Eine weitere bedeutende Episode findet sich im Johannesevangelium. Nach dem Tod ihres Bruders Lazarus bat Martha Jesus um Hilfe. In diesem Moment legte sie ein starkes Glaubensbekenntnis ab: „Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll“ (Joh. 11, 27). Diese Worte sind eine Essenz des christlichen Glaubens und zeigen Marthas tiefes Vertrauen in Jesus und seine göttliche Macht.
Von Betanien nach Frankreich: Die Legende der Drachenbändigerin
Nach der Überlieferung wurden Martha, ihre Geschwister und andere Jünger während der Christenverfolgungen in ein steuerloses Boot gesetzt und landeten durch ein Wunder in Marseille. In der Provence lebte Martha über 30 Jahre und gründete ein Kloster.
Eine besonders faszinierende Legende erzählt, dass Martha in der Nähe von Tarascon den menschenfressenden Drachen Tarasque zähmte. Mit einem Kreuzzeichen und Weihwasser (oder Weihrauch) bändigte sie den Drachen und führte ihn an ihrem Gürtel nach Arles. Eine andere Version berichtet, dass Martha den Drachen in einer Höhle versteckte, um ihn vor den Bewohnern von Tarascon zu schützen, die ihn töten wollten. Diese Legenden entstanden, nachdem 1187 in Tarascon ein Leichnam entdeckt wurde, der als der von Martha identifiziert wurde. In der Kirche Sainte-Marthe werden bis heute ihre Reliquien gezeigt.
Marthas Vermächtnis und ihre Verehrung
Martha wurde oft als Urbild der fleißigen Hausfrau dargestellt, doch ihr Beitrag geht weit über diese Rolle hinaus. Meister Eckhart erkannte Marthas Vorzüge gegenüber ihrer Schwester Maria: Während Maria noch lernen musste, konnte Martha bereits handeln. Marthas Attributen - schlichtes Kleid, Kochlöffel, Weihwedel oder Weihwasserkessel, und ein Drache an einem Strick - spiegeln ihre Rolle als Patronin der Häuslichkeit und derjenigen, die sich um andere kümmern, wider. Sie ist die Schutzpatronin der Hausfrauen, Hausangestellten, Köchinnen, Gastwirte, Hoteliers, Bildhauer und Maler sowie der Sterbenden und wird gegen Blutfluss angerufen.
Marthas Gedenktage werden in verschiedenen christlichen Traditionen gefeiert, wobei der 29. Juli in der katholischen, evangelischen und anglikanischen Kirche am weitesten verbreitet ist.
Martha von Betanien bleibt eine inspirierende Figur, deren Glauben und Handeln auch heute noch Bedeutung haben. Ihr Leben und ihre Legenden erinnern uns daran, wie wichtig es ist, sowohl im Glauben stark zu sein als auch im Handeln zu überzeugen.
Symbolische Beschützerin aller Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen soll auf Recht auf gute Arbeit aufmerksam machen
Die "Katholische Arbeitnehmer:innen Bewegung Österreich" (KABÖ) feiert am Donnerstag den Gedenktag der fiktiven Schutzpatronin Santa Precaria. Die kirchliche Tradition der Schutzheiligen aufgreifend, wurde Santa Precaria als eine symbolische Beschützerfigur für alle Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen kreiert, teilte die KABÖ am Mittwoch gegenüber Kathpress mit. Unter dem Motto "Fair statt prekär - alle haben Recht auf gute Arbeit" seien zahlreiche Aktionen geplant.
"Prekär" lasse sich übersetzen mit "problematisch, unangenehm, misslich, unsicher" und sei ein nicht immer klar fassbares Phänomen, so KABÖ- Vorsitzende Anna Wall-Strasser. "Wer einem Fortschreiten der Prekarisierung entgegenwirken will, muss sich für planbare, zusammenhängende Arbeitszeiten, faire Entlohnung, ausreichende soziale Absicherung und das Recht auf Mitsprache stark machen. Der 29. Februar und unsere 'Santa Precaria' erinnern uns daran", so Wall-Strasser
Kennzeichnend für das Prekariat seien etwa niedriges, nicht kontinuierliches Einkommen, die unkalkulierbare Dauer eines Arbeitsverhältnisses, ungenügender sozialer Schutz, mangelnde Einbindung und Mitbestimmung oder einseitige zeitliche Flexibilisierung zulasten der Beschäftigten. "Sowohl atypische Beschäftigungsverhältnisse wie Zeit- und Leiharbeit, Teilzeit, Praktika oder Freie Dienstverhältnisse als auch Vollzeitanstellungen können prekär sein, es hängt von der Ausprägung der auftretenden Faktoren und deren negativen Auswirkungen auf die finanzielle Lage, die familiäre Situation, die soziale Sicherheit, die Gesundheit und langfristig auf die Alterssicherung ab", betonte die KABÖ-Vorsitzende.
Dieses Jahr finden etwa in Linz mehrere Aktionen statt, um die Prekarisierung von Arbeit in ihren vielfältigen Formen öffentlich zu thematisieren. So laden etwa die KAB OÖ, die Katholische Jugend (kjoö) und die Bischöfliche Arbeitslosenstiftung der Diözese Linz zu einer gemeinsamen öffentlichen Aktion am Donnerstag vor der Ursulinenkirche in der Linzer Landstraße ein. Mit der lebensgroßen Symbolfigur der Santa Precaria, Info-Material und Flyern sollen Vorbeikommende für das Thema sensibilisiert und eingeladen werden.
Am Freitag wird im kirchlichen Begegnungszentrum "Urbi & Orbi/Kirche in der City" in der Linzer Bethlehemstraße zudem der Film "Der marktgerechte Mensch" gezeigt. Dieser Dokumentarfilm und die anschließende Diskussion sollen Menschen anregen, sich vertiefend mit dem Thema zu beschäftigen. (Infos: https://www.dioezese-linz.at/mensch-arbeit)
Quelle:kathpress.at
Am 6. Dezember gedenkt die Kirche einem der am meisten verehrten Heiligen: Dem Hl. Nikolaus von Myra.
Wettergegerbt soll sein Gesicht gewesen sein, seine Nase war durch einen Bruch krumm zusammengewachsen und hatte einen markanten Buckel und, ja, er hatte doch tatsächlich einen weißen Bart, wenn auch einen weit kürzeren als die Nikoläuse, die uns immer wieder in unserer Kindheit Besuche abgestattet haben.
Vielen Kindern ist er bekannt, Lieder über ihn werden gesungen, viele Geschichten von ihm erzählt - und doch zählt er zu den „unbekanntesten“ Heiligen, denn gesicherte Fakten über sein Leben gibt es nur wenige.
Was wir „gesichert“ über Nikolaus wissen
Bei ihm handelt es sich um keine legendenhafte Gestalt, ihn gab es tatsächlich. Aber: viel ist aus seinem Leben uns nicht überliefert worden. Was wir von ihm wissen, ist, dass er zwischen 280 und 286 in Patara (Türkei) geboren wurde, dass er mit etwa 19 Jahren zum Priester geweiht und nur wenig später zum Bischof von Myra (heutiges Demre, etwa 100 Kilometer südwestlich der türkischen Großstadt Antalya) ernannt wurde. Auch ist bekannt, dass in Myra kurz nach seiner Bischofsernennung die Christenverfolgungen unter dem römischen Kaiser Galerius Valerius Maximinus (305 bis 311) begannen. Auch Nikolaus war diesen ausgesetzt, geriet – so die Überlieferung - in Gefangenschaft und wurde in dieser Zeit auch gefoltert. Etwas mehr als 10 Jahre später nahm er am Konzil von Nizäa (325) teil. Sein Todestag war ein 6. Dezember zwischen den Jahren 345 und 351.
Der Kult
Unbestritten ist, dass Nikolaus zu den am meisten verehrten Heiligen der Christenheit zählt und er als Schutzpatron zahlreicher Orte, Gruppen und Berufe alle Hände voll zu tun tat. Der Kult um ihn begann erst rund 200 Jahre nach seinem Tod.
Im 6. Jahrhundert weihte Kaiser Justinian ihm eine Kirche in Konstantinopel (heutiges Istanbul), in welcher Reliquien von Nikolaus verwahrt und verehrt wurden. Über Griechenland, wo er als Hyperhagios (griech. Überheiliger) verehrt wurde, verbreitete sich sein Kult in die slawischen Länder. So kam es, dass heute Nikolaus dort gleich nach der Gottesmutter Maria zu einem der am meisten verehrten Heiligen Russlands wurde. Nach Rom kam der Kult im 8. Jahrhundert und verbreitete sich dann in Süd- und Mitteleuropa. In Deutschland, Frankreich und England ist die Verehrung vom hl. Nikolaus seit dem zehnten Jahrhundert nachweisbar.
Wie groß die Beliebtheit von Nikolaus infolge war, zeigte sich auch darin, dass vom 11. bis zum 16. Jahrhundert diesseits der Alpen mehr als 2200 Kirchen nach ihm benannt wurden.
Wie sah dieser Mann eigentlich aus?
Von den meisten Heiligen haben wir keine reale Vorstellung. Unsere Bilder von ihnen sind geprägt von uns gezeigten Bildern, die aus Bilderbüchern, aus Religionsbüchern stammen, teils auch von Ikonen. Bei Nikolaus besteht da eine Ausnahme: Wissenschaftler der John Moores University in Liverpool haben 2017 mit Hilfe der 3D-Technik und des Gesichtsrekonstiktionsverfahren ein Portrait erstellt, das den heiligen Nikolaus von Myra realistisch darstellen soll. Wer sich von dem popuären Heiligen nun ein Bild machen möchte, der klicke auf https://twitter.com/FaceLabLJMU/status/806168986996080640/photo/1
Der heute verehrte Nikolaus ist eigentlich ein zweifacher Nikolaus
Das Bild und die Vorstellung dieses Heiligen wurde im Laufe der Jahrhunderte durch die vielen Legenden und das mannigfaltige Brauchtum stark ge- und verformt. Der Nikolaus, so wie er heute verehrt wird und wir ihn aus unseren Kindertagen her kennen, ist eine Verschmelzung, eine Kombination von zwei historischen Personen: des Bischofs von Myra und des gleichnamigen Abts Nikolaus von Sion, dem späteren Bischof von Pinara (Türkei)– der im Jahr 564 starb.
Wie oft hat man diesen Satz im Glaubensbekenntnis schon ausgesprochen, aber wie wenig hat man darüber reflektiert, wie selten wurde bewusst gefragt, wer oder was dieser Geist ist. Der Heiligen Geist – eine kurze „Reflexion.“
Nur eine einzige Religion betet den Heiligen Geist an
Die meisten gläubigen Menschen auf der Welt beten. Religionen kennen einen oder mehrere Götter, glauben an gute und böse Geister, aber nur eine einzige Religion kennt und betet den Heiligen Geist an, nämlich das Christentum.
Die Quelle, die Auskunft darüber gibt
Die Quelle, die uns über „Ihn“ Auskunft gibt, ist die Bibel. Das Alte Testament nennt den Heiligen Geist „ruah“, das mit Atem, Hauch, Wind oder sogar Sturm übersetzt werden kann. Ruah ist in diesen alten Schriften der Atem, die Lebenskraft Gottes, die (uns und die ganze Welt) sein lässt. Es ist die schöpferische Kraft Gottes, die aus Chaos den Kosmos werden lässt, es ist die Wirkmächtigkeit, die walten lässt, die erhält und die erneuert. Auf Menschen bezogen befähigt der Heilige Geist immer zu einer bestimmten, gottgewollten Aufgabe.
Im Neuen Testament wird uns durch Jesus der Heilige Geist noch weiter erschlossen. Jesus verspricht in seiner Abschiedsrede, dass er wiederkommen werde und kündigt in der Zwischenzeit den Heiligen Geist an, den er als Paraklet, das heißt Anwalt, Beistand, Helfer bezeichnet (Joh. 14,26). Bis heute ist der Heilige Geist die Antriebskraft und das Lebenselixier der Kirche.
Symbole für den Heiligen Geist
Wenn die Kirche vom Heiligen Geist spricht oder sein Wirken ankündigt, so tut sie dies in symbolhaften Bildern. Der Heilige Geist im Bild von Wind und Atem (denn er ermöglicht, wie die Luft zum Atmen, das Leben), von Wasser (mit diesem Element ist das Leben verknüpft. Denn wo kein Wasser, da auch kein Leben), von Feuer (die Feuerzungen, die über die Apostel kamen und ihnen neuen Mut und Hoffnung schenkten), von der Taube (Taufe Jesu, bei der der Heilige Geist wie eine Taube vom Himmel kam und Besonderes „ankündigte“) , von einem Siegel (der Heilige Geist als Schutz und Zusicherung für die Gläubigen), von Anzahlung und Unterpfand (der Heilige Geist als Zusicherung für das, was die Gläubigen noch erwarten dürfen), von Öl und Salbung (durch diesen wird uns eine besondere Ehrung zuteil – denn gesalbt wurden damals nur Könige, Priester und Propheten. Nun auch wir!)
Die 7 Gaben des Hl. Geistes
Immer wieder „Sieben“: Die Sieben findet sich etliche Male in der Bibel, es ist ein altes biblisches und vorbiblisches Symbol, das für Fülle und Vollkommenheit steht.
Bezüglich der 7 Sakramente kommt noch eine weitere Bedeutung hinzu: Sieben ergibt sich aus 3+4. Drei steht für das Göttliche (die Trinität), 4 für das Irdische. In den Sakramenten kommen beide zusammen, eine Verbindung von Göttlichen und Irdischen entsteht.
Die Bibel nennt im Buch des Propheten Jesaja (Jes 11,1,ff) 6 Gaben des Geistes. Es sind dies die Weisheit, die Einsicht, der Rat, die Stärke, die Erkenntnis und die Gottesfurcht .
Die siebente Gabe wurde von Thomas von Aquin (1226-1274) hinzugefügt: Die Gabe der Frömmigkeit.
Im ersten Brief an die Korinther (1 Kor 12,8-10) werden die Geistgaben mit folgenden Worten beschrieben:
Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den selben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen – immer in dem einen Geist – die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten der Zugenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen.
Die Gaben des Geistes im Einzelnen:
Weisheit
Sie hilft zu erkennen, was wichtig ist (für mich und andere) und was nicht, sie gibt Einblick in das, wofür es sich lohnt zu kämpfen und wofür nicht.
Einsicht
Sie verleiht die Fähigkeit, den Durchblick zu bekommen und zu behalten. Sie eröffnet die Möglichkeit, Einsehen zu haben, Zusammenhänge zu erkennen, in Sachverhalte Einsicht zu gewinnen. Sie weitet den Blick über einen selbst hinaus, macht fähig, sich auch in andere hinein versetzen zu können.
Rat
Dieses Geschenk des Heiligen Geistes soll fähig machen, anderen gute Empfehlungen zu geben – andere im Guten zu beraten, aber auch selbst Ratschläge und Tipps anderer anzunehmen, wenn ich spüre, dass ich auf eine falsche Fährte geraten bin.
Erkenntnis
Bei dieser Gabe geht es um Erkenntnis, geht es um das Wissen. Sie ermöglicht das Herausfinden, welche Kräfte derzeit am Werk sind. Sie versetzt einen in der Lage, sich ein eigenes, kritisches Bild zu machen, das nicht gefärbt ist durch Bilder der Medien oder andere irreführende Meinungen.
Stärke
Es gibt Situationen im Leben des Menschen, wo nicht alles glattläuft, Situationen, in denen man von einer „Schieflage“ des Lebens spricht. Die fünfte Gabe verleiht die Stärke auch dann nicht den Mut zu verlieren, wenn gerade alles „aus den Rudern“ läuft. Der Heilige Geist verleiht auch und gerade dann die Kraft, um in dieser Zeit nicht zu verzweifeln, nicht mutlos zu werden, sondern um diese Krisen zu bewältigen und daran auch noch zu wachsen.
Frömmigkeit
Gott erwartet von uns nicht, dass wir jeden Tag zur Kirche gehen oder täglich mehrmals den Rosenkranz beten. Was Gott möchte, ist, mit uns in Verbindung zu bleiben. Frömmigkeit geschenkt zu bekommen, bedeutet, in die Fähigkeit versetzt zu sein, den Faden zu Gott nie abreißen zu lassen, also immer "online" für ihn und mit ihm zu sein.
Gottesfurcht
Die siebte und letzte Gabe ist die Gottesfurcht. Es geht dabei nicht darum, Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht vor und Liebe zu Gott zu haben. Gottesfurcht bedeutet weiters: Mir wird erschlossen, dass Gott größer und mehr ist als alles mir Bekannte. Gott zu fürchten heißt in diesem Zusammenhang, ihn zu lieben, ihn anzubeten, ihn die Treue zu halten. Aber noch ein zweites ist unter Gottesfurcht zu verstehen, nämlich die Demut. Dieser Begriff ist uns heute ziemlich fremd geworden. Demut meint, dass man sich selber nicht zu wichtig nehmen soll, nicht auf andere herabschauen soll, sondern jeden so zu anzunehmen, wie er ist.
Empfehlungen
„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen
Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen
Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen
13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen
66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen
24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen
Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen
Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen
65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen
Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen
Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen
Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen
"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen
HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen
Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen
Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen
Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen
Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen
Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen
Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen
Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen
Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen
Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen
Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen
Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen
Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen
Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen
Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen
Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen
25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen
Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen
Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen