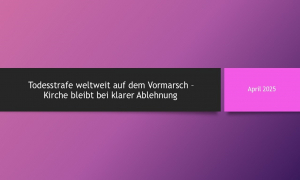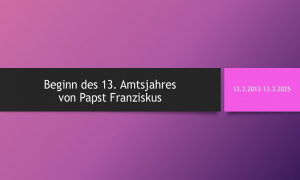Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Am gestrigen Ostermontag ist Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Nachricht vom Tod des Pontifex verbreitete sich am Vormittag rasch – mit großer Betroffenheit in der katholischen Welt und weit darüber hinaus. In Österreich wurde noch am selben Tag in besonderer Weise des verstorbenen Papstes gedacht.
Um 17 Uhr läuteten in ganz Österreich die Kirchenglocken für zehn Minuten – ein Zeichen kollektiver Trauer und des Gebets. Bereits am Vormittag hatte die Pummerin des Wiener Stephansdoms das erste hörbare Zeichen des Abschieds gesetzt, kurz nachdem der Vatikan den Tod des Papstes offiziell bekannt gegeben hatte. Kirchen und kirchliche Einrichtungen im ganzen Land hissten schwarze Fahnen.
„Der Heimgang von Papst Franziskus ist ein tiefer Einschnitt für die Weltkirche. Seine Stimme für Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Frieden wird fehlen“, sagte der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, gegenüber Kathpress.
Am Abend wurde im Wiener Stephansdom ein feierliches Requiem gefeiert, dem Kardinal Christoph Schönborn vorstand. Die Messe war geprägt von stillem Gedenken, Gebet und der Würdigung eines Pontifikats, das durch Bescheidenheit, Menschlichkeit und Reformwille geprägt war.
Papst Franziskus, geboren als Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires, war der erste Papst aus Lateinamerika. Seit seiner Wahl im Jahr 2013 hatte er die katholische Kirche durch seine volksnahe Art, seine Soziallehre und sein Ringen um eine offene Kirche weltweit geprägt. Sein Tod am höchsten christlichen Feiertag berührt Millionen – ein Abschied, der auch über den kirchlichen Raum hinaus nachhallt.
Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA
Mit Trauer, aber auch mit Hoffnung auf die Auferstehung, nehmen wir Abschied von Papst Franziskus. Als Nachfolger des Apostels Petrus hat er die Kirche in einer bewegten Zeit geführt und immer wieder die Liebe Gottes in den Mittelpunkt gestellt.
Papst Franziskus war ein Mann des Gebets, der Demut und der Nähe zu den Menschen. Seine Worte und Taten zeigten, wie wichtig Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und die Sorge um die Schwachen sind. Er hat uns daran erinnert, wie wertvoll die Schöpfung ist, und wie wichtig es ist, sie zu bewahren.
Sein Einsatz für Frieden und Dialog hat weltweit Zeichen gesetzt. Er hat Brücken gebaut, wo Mauern standen, und die Türen der Kirche weit geöffnet. Franziskus war ein Hirte, der den Menschen nahe war und den Glauben mit Freude gelebt hat.
Wir danken Gott für sein Leben und seinen Dienst. Er hat die Kirche bereichert und viele inspiriert. Möge er nun in Gottes Frieden ruhen. Wir beten: „Herr, schenke ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm.“
Militärbischof Werner Freistetter erinnert sich an einen großen Menschen: "Papst Franziskus besaß eine außergewöhnliche Ausstrahlung, die Menschen zutiefst berührt hat. In meinen persönlichen Begegnungen mit ihm habe ich immer wieder gespürt, wie sehr sein Charisma von einer tiefen Menschlichkeit und einer gelebten Spiritualität getragen wurde. Seine Nähe zu den Menschen, geprägt durch seine Erfahrungen in Lateinamerika, spiegelten sich in seinem tiefen Engagement gegen Armut und für Gerechtigkeit und Frieden wider. Besonders habe ich dies beim Ad Limina Besuch im Dezember 2022 gemerkt, der von einer familiären Vertrautheit und Herzlichkeit geprägt war. Bei unserem Besuch Anfang Februar im Heiligen Jahr vermittelte Papst Franziskus in seiner Predigt eine tiefgehende Botschaft über Mitgefühl, Engagement und Verantwortung in Bezug auf die Militärseelsorge.
Mit dem synodalen Prozess hatte Papst Franziskus nicht nur eine Idee ins Leben gerufen, sondern einen entscheidenden Impuls gesetzt. Er hatte etwas angestoßen, das nicht nur Menschen zusammenbringt, sondern zu einer echten Veränderung im Denken und Handeln führen kann. Papst Franziskus ging es nicht nur um ein Gespräch oder einen Austausch, sondern um eine neue Kultur des Miteinanders, die von Respekt, Offenheit und gegenseitigem Verständnis geprägt ist.“
Trotz gesundheitlicher Rückschläge zeigt sich das Kirchenoberhaupt am Palmsonntag vor Tausenden Gläubigen. Die Zeichen mehren sich: Franziskus will Ostern nicht ausfallen lassen.
Ein stiller Auftritt mit starker Wirkung
Vatikanstadt – Es war ein Moment stiller Symbolik: Papst Franziskus, weiß gekleidet, ohne sichtbare Sauerstoffzufuhr, ließ sich am Palmsonntag im Rollstuhl auf die Altarbühne des Petersplatzes fahren. Begleitet von seinem langjährigen Pfleger Massimiliano Strappetti richtete der 88-Jährige wenige Worte an die rund 20.000 versammelten Gläubigen. "Gesegneten Palmsonntag! Gesegnete Heilige Woche!", wünschte er, bevor er in den Petersdom gebracht wurde – ein kurzer, aber bewegender Auftritt, der in seiner Schlichtheit mehr sagte als viele Reden.
Ein Papst auf leisen Pfaden
Im Inneren der Basilika begab sich Franziskus an das Grab des Apostels Petrus sowie zum Denkmal seines Vorgängers Benedikt XV. Dort hielt er stilles Gebet, sprach mit Besuchern – darunter ein Vater mit seiner Tochter, der er Süßigkeiten überreichte – und verabschiedete sich schließlich über einen Seitenausgang zurück in seine Unterkunft im vatikanischen Gästehaus Santa Marta. Eine Szene, die Intimität vermittelte, fern jeder Inszenierung, und dennoch nicht ohne Bedeutung.
Zwischen Schonung und Sendungsbewusstsein
Dass der Papst sich überhaupt zeigte, ist medizinisch gesehen bemerkenswert. Nach einer schweren Lungeninfektion und einem 38-tägigen Krankenhausaufenthalt hatten die behandelnden Ärzte ihm eigentlich zwei Monate Ruhe verordnet. Doch Franziskus scheint anders zu denken. Bereits vor einer Woche überraschte er mit einem Auftritt bei der Messe für Kranke – und nun erneut, ausgerechnet zum Auftakt der Karwoche, dem liturgischen Höhepunkt des Kirchenjahres.
Fortschritte der Genesung
Die gesundheitlichen Fortschritte sind erkennbar: Während Franziskus nach seiner Entlassung aus der Klinik am 23. März kaum sprechen konnte, sind seine Worte inzwischen wieder klarer. Auch auf die Sauerstoffunterstützung verzichtet er zeitweise – ein Signal, das viele als Hoffnungsschimmer für seine Teilnahme an den kommenden Osterfeierlichkeiten deuten.
Spontane Wege, ungewöhnliche Bilder
In den vergangenen Tagen häuften sich unerwartete öffentliche Auftritte des Papstes. Am Samstag besuchte er seine Lieblingskirche, Santa Maria Maggiore, um vor der Ikone Salus populi romani zu beten – eine Geste, die er stets mit wichtigen Momenten seines Pontifikats verband. Am Donnerstag war er in ungewohnter Kleidung – schwarze Hose, weißes Unterhemd, darüber ein gestreifter Poncho – durch den Petersdom gerollt. Und selbst das britische Königspaar empfing er überraschend, nachdem ein offizieller Besuch zuvor aus Rücksicht auf seine Gesundheit abgesagt worden war.
Osterwoche unter Vorbehalt
Ob Franziskus in der Karwoche weitere liturgische Handlungen persönlich übernehmen kann, bleibt offen. Laut Vatikan hängt vieles vom Wetter und seinem jeweiligen Gesundheitszustand ab. Vorerst übernehmen Kardinäle die Zeremonien: So leitete Leonardo Sandri die Palmsonntagsmesse und trug die Predigt des Papstes vor – ein Appell an Mitgefühl und christliche Verantwortung. Franziskus erinnerte darin an Simon von Cyrene, der Jesus beim Tragen des Kreuzes geholfen habe, ohne viele Worte, aber mit Taten: "Bereiten wir uns auf das Osterfest des Herrn vor, indem wir einander beistehen wie Simon von Cyrene."
Zwischen Hoffnung und Ungewissheit
Auch im schriftlich veröffentlichten Mittagsgebet warb der Papst für den Frieden und dankte für die weltweiten Gebete: "In dieser Zeit der körperlichen Schwäche helfen sie mir, Gottes Nähe, sein Mitgefühl und seine Zärtlichkeit noch stärker zu spüren." Ob er am Ostersonntag den traditionellen Segen Urbi et Orbi von der Mittelloggia des Petersdoms spenden kann, wird sich zeigen.
Doch eines scheint klar: Dieser Papst wird – wenn es sein Zustand irgendwie erlaubt – auch das Osterfest 2025 mitgestalten wollen. Mit stiller Beharrlichkeit und einer Botschaft, die über jede körperliche Schwäche hinausweist.
Quelle: kathpress.at, redigiert durch ÖA
Todesstrafe weltweit auf dem Vormarsch – Kirche bleibt bei klarer Ablehnung
Weltweit wurden im vergangenen Jahr so viele Menschen hingerichtet wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Laut dem aktuellen Bericht von Amnesty International wurden in 15 Ländern mehr als 1.500 Todesstrafen vollstreckt – ein drastischer Anstieg, für den vor allem Staaten im Nahen Osten verantwortlich sind. Die Länder mit den meisten Hinrichtungen bleiben China, der Iran, Saudi-Arabien, Irak und Jemen. China verweigert allerdings weiterhin jegliche Offenlegung von Zahlen.
Inmitten dieser alarmierenden Entwicklung erneuert die katholische Kirche unter der Führung von Papst Franziskus ihre entschlossene Ablehnung der Todesstrafe. Der Pontifex hat sich mehrfach und mit großer Deutlichkeit für ihre weltweite Abschaffung ausgesprochen – zuletzt zum Weltfriedenstag am 1. Jänner dieses Jahres. Seine Begründung ist unmissverständlich: Die Todesstrafe verletze nicht nur die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, sondern zerstöre jede Hoffnung auf Reue, Versöhnung und Erneuerung.
Ein klarer moralischer Kompass: Der Papst und die Kirche
Bereits 2018 setzte Papst Franziskus ein klares Zeichen, als er den Katechismus der katholischen Kirche ändern ließ. Darin wird die Todesstrafe seither als "unzulässig" bezeichnet – unter allen Umständen. Es war die bislang einzige Modifikation seit der Veröffentlichung des Katechismus im Jahr 1992 und ein historischer Akt kirchlicher Selbstvergewisserung.
Nicht nur der Papst, auch viele kirchliche Vertreter, wie die US-Ordensfrau Helen Prejean, setzen sich international gegen die Todesstrafe ein. Für sie ist sie nicht nur eine juristische, sondern vor allem eine ethische Frage. Dass Staaten wie die USA – insbesondere seit dem Ende der Corona-Pandemie – die Zahl der Exekutionen wieder erhöhen, stößt in kirchlichen Kreisen auf entschiedene Ablehnung. Die Behauptung, Hinrichtungen dienten der Abschreckung, sei laut Menschenrechtsorganisationen wissenschaftlich längst widerlegt.
Ungleichheit und Missbrauch: Kritik an der Praxis
Der Amnesty-Bericht legt offen, dass mehr als 40 Prozent der Hinrichtungen mit Drogendelikten in Verbindung stehen – allein im Iran über die Hälfte. Solche Urteile stehen im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsstandards, die die Todesstrafe nur bei den "schwersten Verbrechen", etwa Mord, für zulässig halten. Besonders betroffen sind arme Menschen und ethnische Minderheiten – ein Zeichen tiefgreifender Ungerechtigkeit im globalen Strafsystem.
Österreichs Weg: Vom Fallbeil zur klaren Absage
Österreich ist heute ein Land, in dem die Todesstrafe vollständig der Vergangenheit angehört. Doch der Weg dorthin war lang – und nicht frei von blutigen Kapiteln. Die letzte Hinrichtung fand am 24. März 1950 statt. Danach wurde die Todesstrafe im ordentlichen Strafverfahren noch im selben Jahr, am 24. Mai 1950, durch die lebenslange Freiheitsstrafe ersetzt.
Der endgültige Bruch mit dieser Form der Strafjustiz erfolgte am 7. Februar 1968: Die Todesstrafe wurde vollständig aus dem österreichischen Recht gestrichen. Seitdem hat keine Parlamentspartei ernsthaft ihre Wiedereinführung gefordert – ein Konsens, der bis heute Bestand hat.
Ein düsteres Erbe: Die Todesstrafe in Österreichs Geschichte
Historisch reicht die Auseinandersetzung mit der Todesstrafe in Österreich weit zurück. Kaiser Joseph II. versuchte bereits 1787, sie abzuschaffen. Doch schon 1803 wurde sie wieder eingeführt. Nach einem kurzen Verbot in der Ersten Republik ab 1919 wurde sie in den 1930er-Jahren im Zuge autoritärer Entwicklungen wieder eingesetzt – nicht zuletzt als Ausdruck politischer Unterdrückung.
Am düstersten war die Zeit des Nationalsozialismus: Zwischen 1938 und 1945 wurden allein am Wiener Straflandesgericht über 1.180 Menschen hingerichtet, die meisten aus politischen Gründen. Die Justiz wurde zum Instrument des Terrors, das Fallbeil zur täglichen Routine.
Ein endgültiger Abschied vom Töten im Namen des Staates
Nach dem Zweiten Weltkrieg zögerte die junge Republik zunächst, ganz auf die Todesstrafe zu verzichten. Mehrfach wurde sie – oft nur auf Zeit – verlängert. Erst der politische und gesellschaftliche Wandel der 1960er-Jahre ermöglichte ihre endgültige Abschaffung.
Es war ein Akt moralischer Reife – und ein Zeichen für eine Gesellschaft, die sich auf das Leben und nicht auf Rache gründet. Damit steht Österreich heute Seite an Seite mit 113 Staaten weltweit, die die Todesstrafe vollständig abgeschafft haben.
Ein Ruf aus Rom an die Welt
Papst Franziskus mahnt: Die Todesstrafe sei keine gerechte Strafe, sondern Ausdruck eines Unrechts, das das Leben verkennt. Sein Ruf ist klar: "Keine Strafe darf die Hoffnung auf Erlösung und Vergebung auslöschen." In einer Welt, in der Hinrichtungen wieder zunehmen, bleibt seine Stimme eine der deutlichsten – und menschlichsten.
Quellen: kathpress, Hintergrund: Die Todesstrafe in Österreich – DiePresse.com, redigiert durch ÖA
Ein Zeichen der Nähe und Hoffnung für Kranke und Pflegende – trotz eigener Schwäche zeigt sich der Pontifex der Öffentlichkeit.
6. April 2025 – Ein stiller, aber tief bewegender Moment spielte sich am Sonntagmittag auf dem Petersplatz ab. Entgegen aller Erwartungen erschien Papst Franziskus persönlich zum Abschluss einer Messe, die zu Ehren kranker Menschen und medizinischen Personals gefeiert wurde. Im Rollstuhl und sichtlich geschwächt, jedoch mit wachem Blick und einem Lächeln auf den Lippen, ließ er sich zum Altar vor dem Petersdom fahren, um gemeinsam mit dem Hauptzelebranten, Erzbischof Rino Fisichella, den feierlichen Segen zu spenden.
Beifall für einen stillen Kämpfer
Die Reaktion der etwa 20.000 versammelten Gläubigen war überwältigend: Applaus brandete auf, Rufe der Freude und Ergriffenheit erfüllten den Platz. Der Papst, der während seines kurzen Auftritts Sauerstoff zur Unterstützung der Atmung benötigte, bedankte sich herzlich und wünschte allen einen "schönen Sonntag" – „Buona domenica!“. Nach nur wenigen Minuten zog er sich wieder zurück, doch die Wirkung seiner Präsenz hallte lange nach.
Vorbild in Schwäche
Wie das vatikanische Presseamt später bekannt gab, hatte Franziskus bereits am Morgen das Sakrament der Beichte empfangen und die Heilige Pforte des Petersdoms durchschritten – ein symbolischer Akt der geistlichen Reinigung und Hoffnung. Sein körperlicher Zustand, gezeichnet von einem längeren Krankenhausaufenthalt zwischen dem 14. Februar und dem 23. März, hatte bislang keine öffentlichen Auftritte zugelassen. Umso eindrucksvoller war seine Entscheidung, sich trotz medizinischer Anordnung zur Ruhe in der vatikanischen Residenz, den Menschen zu zeigen.
Eine Botschaft aus dem Herzen
In der von Erzbischof Fisichella verlesenen Predigt des Papstes fanden sich einfühlsame und tröstende Worte für jene, die mit Krankheit und Pflege zu kämpfen haben. Die Erfahrung der Schwäche sei eine der härtesten Prüfungen des Lebens, hieß es darin, aber auch eine Gelegenheit, die Nähe Gottes besonders intensiv zu erfahren: „Wenn unsere Kräfte versagen, ist Er es, der uns seine Gegenwart als Trost schenkt.“
Diese Botschaft, aus dem Mund eines Mannes, der selbst gerade die Zerbrechlichkeit des Körpers spürt, gewann an besonderer Tiefe. Franziskus teilte seine eigenen Erfahrungen offen mit den Gläubigen – die Abhängigkeit, das Gefühl von Ohnmacht, aber auch die daraus erwachsene Demut und Dankbarkeit: „Es ist eine Schule, in der wir lernen, zu lieben und uns lieben zu lassen.“
Ein Dank an die stillen Helden
Auch das medizinische Personal wurde in der Predigt bedacht. Ihnen sprach der Papst seinen besonderen Dank aus – nicht nur für ihre professionelle Fürsorge, sondern auch für das Herz, das sie in ihre Arbeit legen. Die Kranken, so betonte er, seien keine Last, sondern ein Geschenk: „Sie können eure Herzen heilen, reinigen von allem, was nicht Liebe ist.“
An der Messe nahmen zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der römischen Gemelli-Klinik teil – jenem Krankenhaus, das den Pontifex während seiner letzten gesundheitlichen Krise betreut hatte. Ihr stilles Wirken im Hintergrund wurde so an diesem Tag ins Licht gerückt.
Ein stiller Auftritt – ein starkes Zeichen
Auch wenn sein Erscheinen nur wenige Minuten währte, so war es doch ein starkes Zeichen der Verbundenheit: Franziskus, der sich mehr und mehr in den Hintergrund zurückzieht, zeigt, dass er weiterhin an der Seite der Menschen steht – besonders der Schwächsten. Mit leiser Stimme, aber großer Geste, hat er einmal mehr deutlich gemacht: Seine Botschaft ist lebendig, auch – und vielleicht gerade – in der eigenen Verletzlichkeit.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht liegt vor ihm. Doch mit der Rückkehr in die eigenen Mauern beginnt für das Kirchenoberhaupt nicht nur eine Phase der Erholung, sondern auch eine neue Etappe seines Pontifikats.
Ein symbolischer Abschied von der Klinik
Die Nachricht kam schneller als erwartet: Am Samstag verkündeten die behandelnden Ärzte, dass der Papst bereit sei, das Krankenhaus zu verlassen. Nur einen Tag zuvor hatte der einflussreiche Kardinal Victor Fernandez bereits "Überraschungen" angekündigt und von der stabilen Verfassung des Pontifex berichtet. Die Entscheidung zur Entlassung fiel nicht zuletzt aus medizinischen Gründen – in der Klinik war das Risiko einer Infektion hoch, und so wurde sein Genesungsprozess in die sichereren Mauern des Vatikans verlagert.
Ein letzter Halt in Santa Maria Maggiore
Bevor Franziskus in den Vatikan zurückkehrte, steuerte sein Fahrzeug einen symbolträchtigen Ort an: die Marienkirche Santa Maria Maggiore. Traditionell betete er dort vor der Marienikone, doch diesmal verzichtete er darauf und ließ stattdessen einen Blumenstrauß durch Kardinal Rolandas Makrickas niederlegen. Ein Zeichen seiner weiterhin eingeschränkten Kräfte, aber auch ein Akt der Dankbarkeit für die Genesung.
Eine neue Phase des Pontifikats
Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich das Pontifikat unter diesen neuen Bedingungen gestaltet. Der 88-jährige Papst muss sich an strikte Vorgaben halten: wenig sprechen, keine größeren Menschenansammlungen, viele Ruhephasen. Dennoch dürfte er nicht zurückweichen. Schon in früheren gesundheitlichen Krisen hat er sich neu erfunden – etwa als "Papst im Rollstuhl" im Jahr 2021. Nun wird spekuliert, ob er seine Amtsführung weiter anpassen und verstärkt auf ein Team aus Kardinälen setzen wird.
Besonders spannend bleibt die Rolle seines Vertrauten Kardinal Fernandez. Wird Franziskus eine neue Form der Mitsprache etablieren und seine Reformideen auch innerhalb der Kurie durchsetzen? Der neunköpfige Kardinalsrat, der bereits die Verwaltungsreform des Vatikans vorangetrieben hat, könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen.
Herausforderungen und offene Fragen
Neben der eigenen Gesundheit stehen für Franziskus drängende Fragen an. Die Finanzlage des Vatikans ist angespannt – der Papst hat selbst eingeräumt, dass Pensionszahlungen für Angestellte gefährdet sind. Erste Maßnahmen zur Neustrukturierung der Finanzen wurden bereits im Krankenhaus getroffen, doch deren Erfolg bleibt abzuwarten.
Zudem geht die innerkirchliche Reformdebatte weiter. Themen wie die Rolle der Frau in der Kirche und die Möglichkeit eines offeneren Zugangs zum Priesteramt harren noch immer einer Entscheidung. Franziskus hat den Diskussionsprozess um drei Jahre verlängert – vielleicht ist nun der Moment für neue Impulse gekommen.
Ein Papst zwischen Schwäche und neuem Rückenwind
Die schwere Erkrankung hat nicht nur Fragen zur Zukunft des Pontifikats aufgeworfen, sondern dem Papst auch eine Welle der Unterstützung eingebracht. Von Reformbefürwortern bis hin zu konservativen Kreisen wurde für seine Genesung gebetet, der Respekt für seine Lebensleistung ist gewachsen. Dieses neu gewonnene Vertrauen könnte ihm Rückenwind für kommende Entscheidungen geben.
Doch mit der körperlichen Schwäche wächst auch die Gefahr, dass sich ein enger Zirkel aus Beratern bildet, der zunehmend in seinem Namen spricht – ein Muster, das man bereits aus der späten Amtszeit Johannes Pauls II. kennt. Ob Franziskus es schafft, diesen Prozess zu verhindern und weiterhin selbst die Weichen zu stellen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.
Eines ist jedoch sicher: Die Zeit der großen Überraschungen ist noch nicht vorbei.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrüttet ist, erhebt Papst Franziskus seine Stimme aus ungewohnter Umgebung. Aus der römischen Gemelli-Klinik heraus, in der er sich derzeit in medizinischer Behandlung befindet, richtete er ein eindringliches Schreiben an die italienische Tageszeitung Corriere della Sera. Der Inhalt: ein leidenschaftliches Plädoyer für Abrüstung, Diplomatie und eine verantwortungsvolle Medienkultur.
"Wir müssen das Reden abrüsten, das Denken abrüsten, die ganze Erde abrüsten", so der Pontifex in seinem an Chefredakteur Luciano Fontana gerichteten Brief. Seine Worte durchziehen ein tiefes Bewusstsein für die Notwendigkeit des Friedens. Er betont, dass eine friedvolle Zukunft nur durch "Nachdenken, innere Ruhe und ein Verständnis für die Komplexität der Welt" erreichbar sei. Krieg hingegen bringe nichts als Zerstörung – er vernichte Gesellschaften, verwüste die Umwelt und löse keine Konflikte.
In einer deutlichen Mahnung richtet sich Franziskus an die internationale Gemeinschaft: Diplomatie und globale Institutionen müssten gestärkt und belebt werden. Ohne sie fehle es der Welt an den notwendigen Instrumenten zur friedlichen Konfliktbewältigung. Besonders die Medien und ihre Verantwortung im gesellschaftlichen Diskurs stehen im Fokus seiner Kritik. Worte seien nicht bloße Aussagen, sondern Taten, die eine soziale Realität schaffen. Sie könnten verbinden oder trennen, der Wahrheit dienen oder sie manipulieren. "Es ist entscheidend, Worte zu entschärfen, um sowohl die Gedanken als auch die Erde selbst zu entschärfen", so der Papst.
Neben der Diplomatie sieht er auch die Religionen in der Pflicht, Frieden zu stiften. Sie sollten sich, so Franziskus, "auf die Spiritualität der Völker stützen", um den Wunsch nach Gerechtigkeit, Geschwisterlichkeit und Hoffnung auf Frieden neu zu entfachen. Dies verlange jedoch "Engagement, Arbeit, Schweigen und Worte" – ein behutsames, aber entschiedenes Wirken für eine bessere Welt.
Persönlich reflektiert der Papst in seinem Schreiben über die eigene Verwundbarkeit angesichts seiner gesundheitlichen Situation. "Die menschliche Zerbrechlichkeit macht uns klarer bewusst, was wirklich bleibt und was vergeht, was Leben fördert und was es zerstört." Gerade diese Erkenntnis lasse ihn den Wahnsinn des Krieges umso deutlicher sehen. Die Gesellschaft neigt dazu, Gebrechlichkeit zu meiden, doch gerade sie sei es, die uns zum Nachdenken zwinge: Über unsere Entscheidungen, unser Handeln und die Richtung, die wir als Gemeinschaft eingeschlagen haben.
Mit seinen Worten aus der Klinik formuliert Franziskus keinen resignierten Appell, sondern einen leidenschaftlichen Weckruf. Inmitten globaler Unsicherheit erinnert er die Welt daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist – sondern eine bewusste Entscheidung.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Zum 12. Jahrestag seines Pontifikats steht Papst Franziskus nicht für Feierlichkeiten im Mittelpunkt, sondern wegen anhaltender Rücktrittsgerüchte. Seit Wochen fehlt der 88-Jährige in der Öffentlichkeit, seine gesundheitliche Verfassung bleibt ein Rätsel. Während das vatikanische Presseamt täglich beruhigende Updates liefert, wächst die Unsicherheit: Wann kehrt der Papst aus der Klinik zurück – oder kehrt er überhaupt zurück? Spekulationen über eine geheime Papstwohnung und mögliche Rücktrittspläne heizen die Debatte an. Entscheidend wird sein, ob Franziskus sich gesundheitlich in der Lage sieht, sein Amt weiterzuführen. Doch klare Antworten aus dem Vatikan gibt es vorerst nicht. (Ein Hintergrundbericht von Kathpress-Korrespondent Ludwig Ring-Eifel)
Um sein Amtsjubiläum hat Papst Franziskus nie viel Aufhebens gemacht. Im Vatikan ist der Tag der Papstwahl zwar gesetzlicher Feiertag. Aber nur einmal, zum zehnten Jahrestag am 13. März 2023, hat Franziskus aus diesem Anlass einen Gottesdienst in der Kapelle des Gästehauses Santa Marta gefeiert.
In diesem Jahr herrscht zum Jubiläumsdatum eine gewisse Nervosität im Vatikan. Knapp einen Monat ist der Papst nun schon abwesend. Außer einer kurzen Ton-Aufnahme seiner nach Luft ringenden Stimme gab es kein Lebenszeichen. Zwar informiert das vatikanische Presseamt täglich darüber, was er tut. Die Medienleute erfahren, dass der 88-Jährige gefrühstückt und gebetet hat, dass er Physiotherapie macht, Medikamente und Sauerstoff erhält - und dass er während der vier Wochen in der Gemelli-Klinik schon mehr als 30 Bischöfe ernannt hat.
Doch seit einigen Tagen konzentrieren sich ihre Fragen auf ein neues Thema: die Entlassung des Papstes aus dem Spital und die Rückkehr. Antworten erhalten sie nicht. "Die Ärzte sind in Bezug auf ein Datum hinreichend vage", erläutert Vatikansprecher Matteo Bruni die Kommunikationsstrategie des Ärzteteams unter Führung des römischen Internisten Sergio Alfieri.
Der Vatikan filtert jedes Wort
Aber es sind nicht allein die Mediziner, die derzeit die heikle Kommunikation zum Thema Papst-Rückkehr zu steuern versuchen. Das vatikanische Staatssekretariat filtert jedes Wort und achtet darauf, dass nichts mitgeteilt wird, was unangemessene Erwartungen anheizen könnte. Die beiden Spitzen dieser Behörde, der Kardinalstaatssekretär und der Substitut, sind seit vier Wochen die einzigen aus dem Vatikan, die den Papst gesehen und - im Rahmen des Möglichen - mit ihm gesprochen haben. Sie haben ihn laut Vatikanangaben informiert und die dringendsten Amtsgeschäfte mit seiner Zustimmung geregelt.
Aber selbst das Staatssekretariat schafft es nicht, die Mitglieder des Kardinalskollegiums und die "Vaticanisti" in den italienischen Medien zu steuern. Und so gibt es in diesen beiden Sphären immer neue spannende Debatten. Eine davon dreht sich um das Thema Rücktritt.
Manche Kardinäle wie der Italiener Gianfranco Ravasi oder der Franzose Jean-Marc Aveline erklärten den Amtsverzicht für denkbar, falls der Papst körperlich nicht mehr könne. Andere schlossen einen solchen Schritt fast kategorisch aus - darunter Konservative wie der Deutsche Gerhard Ludwig Müller, aber auch Reformer wie der Italiener Matteo Zuppi. Unterschiedliche Deutungen des schweren Leidens des Papstes waren zu hören. Während die einen es mit dem Leiden Christi am Kreuz verglichen - so etwa der Pole Stanislaw Dziwisz - sprach der Schweizer Kurt Koch ganz menschlich von einer "schweren Prüfung".
Eine geheime Papstwohnung
In Italiens Medien hat unterdessen eine weitere Debatte begonnen. Anlass war eine Verlautbarung aus dem Vatikan, wonach die Papstwohnung in Santa Marta derzeit nicht so umgebaut wird, dass sie für einen 88-Jährigen mit chronischer Atemwegserkrankung angemessen wäre. Seither wird spekuliert, ob der Papst überhaupt in den Vatikan zurückkehren wird.
Als Alternative hat die Zeitung "Il Secolo d'Italia" eine Rückkehr in die bislang geheim gehaltene Papstwohnung neben der Basilika Santa Maria Maggiore ins Spiel gebracht. Diese Wohnung wurde schon vor längerer Zeit mit den medizinischen Apparaturen ausgestattet, die der Papst bei seinem komplexen Krankheitsbild zum Überleben braucht.
Sie wurde nach Kathpress-Informationen im Zuge der baulichen und personellen Neuordnung der Papstbasilika eingerichtet, die von 2021 bis Anfang 2024 dauerte. Am 20. März 2024 stattete der Papst den litauischen Erzbischof Rolandas Makrickas, der den Umbau geleitet hat, mit weitreichenden Sondervollmachten aus. Wenige Monate zuvor, im Dezember 2023, hatte Franziskus in einem Interview gesagt, dass er in dieser Basilika begraben werden solle. Am 7. Dezember 2024 wurde der gelernte Vatikandiplomat Makrickas zum Kardinal befördert.
Ob diese Mosaiksteine ausreichen, um die These des "Secolo" zu stützen? Laut der Zeitung hat Franziskus so wie einst Benedikt XVI. damit bereits seinen Altersruhesitz für die Zeit nach seinem Rücktritt vorbereitet. Entscheidend ist, ob die gesundheitliche Beeinträchtigung des Papstes so extrem bleibt, dass er sie als Anlass für einen Amtsverzicht sieht. Der Vatikan könnte derartigen Spekulationen den Wind aus den Segeln nehmen, wenn er die Rückkehr des Papstes in den Vatikan zum Osterfest (20. April) ankündigen würde. Doch das erlauben die Ärzte vorerst nicht.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Es war ein Abend, der Geschichte schrieb: Der 13. März 2013, als auf dem Petersplatz tausende Menschen gespannt in den römischen Himmel blickten, aus dem kurz zuvor das erlösende „Habemus Papam“ erklungen war. Und dann trat er auf die Loggia des Petersdoms – schlicht, bescheiden, mit einem freundlichen Lächeln und den einfachen Worten: „Brüder und Schwestern – guten Abend.“ Damit war klar: Ein neuer Stil hielt Einzug in das höchste Amt der katholischen Kirche.
Ein Papst der Nähe und Menschlichkeit
Jorge Mario Bergoglio, der Argentinier mit italienischen Wurzeln, war von Beginn an ein Pontifex, der die Herzen berührte. Er bat die Menschen zuerst um ihr Gebet, bevor er selbst den Segen erteilte – eine Geste tiefer Demut, die seinen Führungsstil prägen sollte. Seit jenem historischen Moment gewann der „Papst vom anderen Ende der Welt“ mit seiner Herzlichkeit, Bodenständigkeit und seinem unermüdlichen Einsatz für die Schwachen weltweit Sympathien. Auch während seiner jüngsten Krankheitsphase zeigte sich seine besondere Verbindung zu den Menschen: Millionen beteten für ihn, selbst jene, die der Kirche fernstehen.
Der Bruch mit alten Traditionen
Der erste Jesuit auf dem Stuhl Petri brachte frischen Wind in das oft als starr empfundene Kirchengefüge. In Kontrast zu seinem Vorgänger Benedikt XVI., dem intellektuellen Theologen und Bewahrer kirchlicher Traditionen, setzte Franziskus auf Einfachheit. Statt prunkvoller roter Schuhe trägt er schlichte schwarze, und die päpstlichen Gemächer im Apostolischen Palast tauschte er gegen eine bescheidene Unterkunft im vatikanischen Gästehaus Santa Marta. Handküsse und zeremonielle Förmlichkeiten sind ihm fremd – stattdessen drückt er Hände, tröstet Kranke, lacht mit Kindern und schenkt ihnen Süßigkeiten.
Auch für die Zeit nach seinem Pontifikat hat Franziskus vorgesorgt: Er entschied sich für eine schlichte Beisetzung in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore – ein weiteres Zeichen seiner Bescheidenheit.
Medienpapst und Brückenbauer
Franziskus ist ein Papst der Kommunikation – nahbar wie keiner vor ihm. Mit zahlreichen Interviews, Social-Media-Auftritten und überraschenden TV-Statements hat er das Bild des Papsttums modernisiert. Erst im Januar 2025 sorgte er für Aufsehen, als er sich live in eine italienische Talkshow zuschalten ließ und dabei eine bahnbrechende Entscheidung verkündete: Er ernannte eine Frau zur Regierungschefin des Vatikanstaats. Schwester Raffaella Petrini übernahm am 1. März das Amt, das traditionell Kardinälen vorbehalten war – ein deutliches Signal für den Wandel, den Franziskus in der Kirche anstrebt.
Die Weltsynode, eines seiner größten Reformprojekte, soll Laien mehr Mitbestimmung ermöglichen. Doch während er Frauen in Führungspositionen fördert, bleibt das Priesteramt weiterhin Männern vorbehalten – ein Punkt, der in kirchlichen Reformkreisen auf Kritik stößt.
Ein kräftezehrendes Jubiläumsjahr
Das Jahr 2025 sollte der strahlende Höhepunkt seines Pontifikats werden – ein Heiliges Jahr mit Millionen Pilgern aus aller Welt. Doch gesundheitliche Rückschläge begleiten den Papst zunehmend. Immer wieder muss er sich von Kardinälen vertreten lassen, zuletzt nach zwei Stürzen, die ihm Prellungen und einen Bluterguss einbrachten. Seit 2022 ist er oft auf den Rollstuhl angewiesen, im Sommer 2023 unterzog er sich einer Bauchoperation.
Trotz aller Einschränkungen bleibt er aktiv: Rund 50 Auslandsreisen hat Franziskus bereits unternommen. Im ersten Halbjahr 2025 steht eine historische Reise in die Türkei an – zur Feier des 1.700-jährigen Konzils von Nicäa, das das bis heute gültige Glaubensbekenntnis formulierte.
Vorher jedoch richten sich alle Augen auf Ostern: Wie präsent wird der Papst bei den wichtigsten Feierlichkeiten des christlichen Kalenders sein? Die kommenden Wochen werden zeigen, mit welcher Kraft Franziskus sein 13. Amtsjahr bestreiten wird – doch eines steht fest: Der Papst vom anderen Ende der Welt hat die Kirche verändert wie kaum ein anderer.
Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA
25. Februar 2025 – Der Petersplatz füllt sich langsam mit Gläubigen, Kerzen flackern im kühlen Abendwind, Rosenkränze gleiten durch betende Finger. Doch anders als 2005, als Johannes Paul II. auf seinem Sterbebett in den Apostolischen Gemächern lag und die Menschen spontan zu Gebeten zusammenströmten, folgt die aktuelle Gebetswelle einer geplanten Choreografie des Vatikans. Papst Franziskus verbringt bereits die zweite Woche im römischen Gemelli-Krankenhaus, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, während die Kurie um Haltung ringt.
Eine improvisierte Tradition
Die katholische Kirche kennt Rituale für das Ende eines Pontifikats, doch was geschieht, wenn ein Papst schwer erkrankt, ohne sein Amt niederzulegen? Hier fehlt das Protokoll. Und so sucht der Vatikan nach Inspiration in der eigenen Geschichte: Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, enger Vertrauter des Pontifex, führte das erste offizielle Gebet und bemühte sich um historische Parallelen. Er erinnerte daran, dass selbst der Apostel Petrus in Ketten die Gebete der frühen Christen empfing. Die Schola intonierte schließlich das lateinische Gebet aus dem Römischen Messbuch: "Beten wir für unseren Pontifex Franziskus. Der Herr behüte ihn und erhalte sein Leben; er lasse ihn gesegnet sein auf Erden und übergebe ihn nicht dem Hass seiner Feinde."
Ein Satz, der Brisanz birgt. Denn wenn auch kaum Feinde des Papstes unter den Betenden zu finden sind, so reihen sich dort durchaus Männer ein, die sich mit Franziskus überworfen haben – manche von ihnen mit tiefen, schmerzhaften Narben.
Kritiker im Gebet – ungeliebte Verbündete
Die Liste derer, die Franziskus' Kurs offen oder subtil infrage stellten, ist lang. Zu nennen wären da der US-Kardinal Raymond Leo Burke, einst einflussreicher Kirchenjurist und strikter Vertreter traditioneller katholischer Werte. Franziskus entzog ihm nahezu jede Position im Vatikan, Gerüchten zufolge sollte ihm sogar die Dienstwohnung genommen werden. Und dennoch betete Burke mit gesenktem Haupt auf dem Petersplatz.
Kaum weniger bemerkenswert ist die Anwesenheit von Kardinal Angelo Becciu. Er fiel tief: Als rechte Hand des Papstes in finanzpolitischen Angelegenheiten entlassen, nach einem millionenschweren Immobilienskandal vor Gericht gestellt und zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt, ist seine rückhaltlose Loyalität zu Franziskus inzwischen Geschichte. Doch auch er kniete sich in die Reihen der Betenden.
Ebenfalls dabei: Gerhard Ludwig Müller, deutscher Kurienkardinal und ehemaliger Präfekt der Glaubenskongregation. 2017 entmachtete ihn Franziskus, nachdem theologische Differenzen unüberbrückbar geworden waren. Doch nun stand Müller neben den Getreuen des Papstes, um für seine Gesundheit zu bitten.
Eine gespaltene Kirche – vereint in Unsicherheit
Nicht nur im Gebet, sondern auch in der aktuellen Debatte um einen möglichen Rücktritt des schwer erkrankten Papstes zeigt sich eine ungewohnte Allianz. Während der als progressiver Franziskus-Freund bekannte Kardinal Matteo Zuppi vehement gegen einen Amtsverzicht argumentiert, stimmt ihm ausgerechnet der konservative Müller zu. Ein Zeichen, dass selbst die innerkirchlichen Gegensätze angesichts der ungewissen Zukunft des Papsttums einer pragmatischen Solidarität weichen.
Doch was bedeutet dies für die katholische Kirche? Die Krankheit von Papst Franziskus hat eine Kurie aufgeschreckt, die in den letzten Jahren immer wieder von internen Machtkämpfen und Affären erschüttert wurde. Während sich die Kardinäle im Gebet versammeln, laufen hinter verschlossenen Türen bereits die strategischen Planungen für die Zukunft.
Die Weltkirche blickt in diesen Tagen mit gespannter Aufmerksamkeit auf Rom – nicht nur in Sorge um das Leben des 87-jährigen Pontifex, sondern auch mit der Frage, wie lange der brüchige Friede unter seinen Anhängern und Kritikern noch Bestand haben wird.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Empfehlungen
Aschermittwoch: Der Beginn der Fastenzei…

Der Aschermittwoch stellt den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit im Christentum dar, die sich bis Ostern erstreckt. Seit dem 6. Jahrhundert wird der Mittwoch als Aschermittwoch bezeichnet, der vor dem sechsten... Weiterlesen
Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen
„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen
Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen
Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen
13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen
66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen
24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen
Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen
Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen
65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen
Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen
Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen
Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen
"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen
HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen
Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen
Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen
Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen
Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen
Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen
Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen
Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen
Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen
Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen
Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen
Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen
Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen
Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen
Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen
Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen
25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen