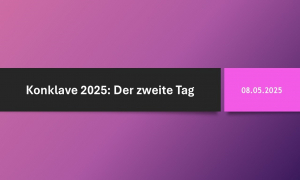Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Feierliche Inbesitznahme der Lateranbasilika als krönender Abschluss der Amtseinführung
Rom, 26. Mai 2025 – Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Lateranbasilika hat Papst Leo XIV. am Sonntagabend seine Kathedra bestiegen und damit auch offiziell das Amt des Bischofs von Rom angetreten. Inmitten von Applaus und Gebeten der Gläubigen und Geistlichen setzte sich der erst am 8. Mai gewählte Papst auf den antiken Bischofsthron – ein bedeutungsvoller Schritt, der in der jahrhundertealten Tradition des Pontifikats tief verwurzelt ist.
Nicht der Petersdom, sondern der Lateran
Oft verkannt, aber kirchenrechtlich eindeutig: Nicht der Petersdom, sondern die Lateranbasilika ist die eigentliche Bischofskirche des Papstes. Hier steht seine Kathedra, hier wurzelt die Verbindung des Papstes mit der Stadt und Diözese Rom. Mit dem gestrigen Akt vollendete Leo XIV. die liturgischen Riten seiner Amtseinführung – der Schritt war mehr als symbolisch: Er manifestierte seine pastorale Verantwortung für das zweitgrößte Bistum Italiens.
„Kluge und prophetische Initiativen“
In seiner Predigt richtete Leo XIV. den Blick auf die Herausforderungen seiner Diözese. Der Weg sei „anspruchsvoll“ und noch längst nicht abgeschlossen, sagte er. Es gehe darum, aufmerksam zu erkennen, was gebraucht wird, und den Mut zu haben, neue Wege zu gehen – in Evangelisierung ebenso wie in konkreter Nächstenliebe.
„Diese Kirche hat so oft bewiesen, dass sie groß denken kann“, so der Papst. Jetzt sei erneut die Zeit gekommen, sich mutigen Projekten zu stellen und die komplexe Realität der Stadt Rom als Chance zu begreifen.
Ein Neuanfang nach Franziskus’ Umbau
Die Diözese Rom befindet sich noch immer im Wandel. Unter Papst Franziskus (2013–2025) wurde sie personell wie strukturell neu aufgestellt. Kardinal De Donatis, lange Jahre Vikar des Papstes, wechselte 2024 in den Vatikan. Kardinal Baldassare Reina führt seither das operative Amt in der Diözese.
Leo XIV. kündigte an, auch künftig auf synodale Zusammenarbeit zu setzen: „Ich will zuhören, lernen, verstehen – und gemeinsam entscheiden.“ Seine Botschaft an die römischen Gläubigen: „Bitte begleitet mich mit euren Gebeten und eurer Liebe.“
Dabei zitierte er liebevoll einen berühmten Vorgänger: „Ich drücke euch meine ganze Zuneigung aus“, sagte Leo XIV. mit den Worten von Johannes Paul I. „Ich möchte Freuden, Sorgen, Mühen und Hoffnungen mit euch teilen – und euch das Wenige geben, das ich bin.“
Mariengebet und Begegnung mit dem Volk
Nach dem Gottesdienst in San Giovanni in Laterano begab sich der Papst im Papamobil weiter zur Basilika Santa Maria Maggiore. Dort verweilte er im Gebet vor der Gnadenikone „Salus Populi Romani“, einer tief verehrten Darstellung der Gottesmutter, bevor er auch das Grab seines Vorgängers Franziskus besuchte. Draußen jubelten ihm Tausende Menschen zu. Noch einmal erteilte Leo XIV. den Segen – ein stiller, kraftvoller Moment auf dem nächtlichen Platz.
Der erste Schritt auf einem langen Weg
Mit den gestrigen Zeremonien endet nun die mehrtägige liturgische Einführung von Papst Leo XIV. – einem Mann, der leise Töne anschlägt, klare Worte findet und vor allem eines ausstrahlt: pastorale Nähe. Nach dem Amtseinführungsgottesdienst im Petersdom vor einer Woche und der Inbesitznahme von St. Paul vor den Mauern am Dienstag, ist sein Amt als Papst und Bischof von Rom nun vollständig angetreten.
Der Weg ist geebnet. Der Stuhl ist eingenommen. Und die Kirche Roms – wie auch die Welt – blickt gespannt darauf, wie dieser Weg weitergeht.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei dieser bedeutenden Zeremonie passiert, wer teilnimmt und warum es keine Inthronisierung mehr gibt: Hier werden die zentralen Fragen rund um den Amtsantritt des neuen Pontifex beantwortet.
Ab wann ist Leo XIV. eigentlich offiziell Papst?
Streng genommen: Seit dem Moment, in dem er seine Wahl annahm und seinen Papstnamen bekannt gab. Mit diesem Akt wurde Robert Francis Prevost zum Bischof von Rom – und damit zum neuen Oberhaupt der katholischen Weltkirche. Die bevorstehende Amtseinführung ist eine feierliche Bestätigung dieses Schritts – ein öffentlicher Akt, bei dem er symbolisch und liturgisch mit Insignien ausgestattet wird und erstmals als Papst mit der Weltkirche Eucharistie feiert.
Wie gestaltet sich die Amtseinführung?
Die Messe zur Amtseinführung – angesetzt für Sonntag, 10 Uhr – folgt einem klaren liturgischen Ablauf und dauert rund zwei Stunden. Musikalisch ist noch nicht alles bekannt, traditionell aber erklingen zum Abschluss eines solchen Hochamts Stücke wie das feierliche „Te Deum“ oder das österliche „Regina Caeli“. Letzteres hatte Leo XIV. bereits beim Angelusgebet intoniert – ein Zeichen für seinen persönlichen Stil.
Wird es auch eine Inthronisierung geben?
Nein – diese traditionelle Zeremonie wurde bereits 1978 durch Papst Johannes Paul I. abgeschafft. Heute ersetzt die erste Messe mit den Kardinälen diese Form der Amtseinsetzung. Leo XIV. feierte diese bereits am Tag nach seiner Wahl. Die öffentliche Amtseinführung dient der weltweiten Kirche und internationalen Öffentlichkeit als sichtbares Zeichen des neuen Pontifikats.
Welche Symbole erhält der neue Papst?
Am Morgen vor der Messe begibt sich Leo XIV. an das Grab des Apostels Petrus – direkt unter dem Petersdom. Dort werden ihm drei zentrale Insignien überreicht:
Das Pallium: eine schlichte, mit roten Kreuzen bestickte Wollstola, die seine Hirtensorge symbolisiert.
Der Fischerring: einzigartig für jeden Papst, ein Zeichen der apostolischen Vollmacht. Nach dem Tod eines Papstes wird dieser traditionell zerstört.
Die Ferula: ein gerader Hirtenstab ohne Krümme – exklusiv dem Papst vorbehalten.
Wer wird zur Amtseinführung erwartet?
Die Gästeliste wird final meist erst am Vortag veröffentlicht – dennoch sind einige Namen bereits bekannt. Aus Österreich wird Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) anreisen, Deutschland wird von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vertreten.
Aus dem britischen Königshaus wird Prinz Edward erwartet – weder König Charles noch Prinz William reisen an. Auch mit der Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird gerechnet. Bei der Amtseinführung von Franziskus 2013 waren über 130 Delegationen vor Ort, darunter über 30 Staatsoberhäupter – ein ähnliches Szenario ist auch diesmal wahrscheinlich.
Wird US-Präsident Donald Trump teilnehmen?
Bislang gibt es hierzu keine offizielle Bestätigung. Möglicherweise entsendet die US-Regierung nur Vizepräsident J.D. Vance. Papst Leo XIV. hatte sich vor seiner Wahl in sozialen Netzwerken kritisch von bestimmten Positionen des Präsidenten und dessen Stellvertreters – insbesondere zur Migrationspolitik – distanziert. Dennoch gratulierte Trump dem neuen Pontifex zur Wahl.
Welche religiösen Würdenträger nehmen teil?
Die meisten Kardinäle sowie zahlreiche Bischöfe, Ordensleute und Delegierte der katholischen Ostkirchen haben ihre Teilnahme angekündigt. Auch der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomaios I., wird anreisen – ein starkes Zeichen der Ökumene.
Aus Österreich werden unter anderem Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der Bischofskonferenz, sowie Bischof Wilhelm Krautwaschl erwartet. Die deutsche Kirche ist durch Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, sowie Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, vertreten.
Wie steht es um die Sicherheitsvorkehrungen?
Rom ist auf Großveranstaltungen dieser Art gut vorbereitet – insbesondere seit den letzten Pontifikaten. Bereits bei der Beerdigung von Papst Franziskus galten höchste Sicherheitsmaßnahmen, wie immer bei der möglichen Anwesenheit eines US-Präsidenten. Für die erwarteten rund 100.000 Gäste am Sonntag wird mit umfassenden Sicherheitskontrollen und längeren Wartezeiten gerechnet.
Ein historischer Moment steht bevor: Die katholische Welt richtet den Blick auf Rom, wenn Leo XIV. in sein Amt eingeführt wird – ein Papst mit klaren Botschaften, großer Geste und internationalem Interesse.
Quelle: Anna Mertens auf kathpress, redigiert durch ÖA
In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über die Verantwortung der Presse, sondern auch über deren bedrohte Freiheit – und mahnte zur Rückkehr zu einer Sprache des Friedens.
Ein Papst mit Humor – und klarer Haltung
„Buongiorno! Good morning!“ – mit einem herzlichen Gruß auf Italienisch und Englisch begann Papst Leo XIV. seine Rede vor Tausenden von Journalistinnen und Journalisten in der vatikanischen Audienzhalle. Die Stimmung: feierlich, erwartungsvoll, bewegt. Und doch eröffnete der neue Pontifex, der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri, mit einem Scherz: „Man sagt, wenn die Leute am Anfang applaudieren, bedeutet das nicht viel. Entscheidend ist, ob sie am Ende noch wach sind.“
Doch seine Botschaft war alles andere als oberflächlich. Mit deutlichen Worten würdigte Leo XIV. die Arbeit von Medienschaffenden weltweit – besonders jenen, die unter Gefahr für Leib und Leben berichten, oder gar inhaftiert wurden, weil sie der Wahrheit verpflichtet bleiben.
Solidarität mit der Wahrheit – und jenen, die sie berichten
„Danke, liebe Freunde, für Ihren Einsatz für die Wahrheit“, sagte der Papst. Der Einsatz der Presse für Gerechtigkeit, Würde und das Recht der Menschen auf verlässliche Informationen sei unverzichtbar. „Denn nur informierte Menschen können freie Entscheidungen treffen.“
Mit Nachdruck forderte Leo XIV. die Freilassung aller inhaftierten Journalistinnen und Journalisten, die ihrer Aufgabe nachgingen, „weil sie die Wahrheit suchen und berichten“. Das Leid dieser Menschen fordere das Gewissen der Weltgemeinschaft heraus. Der Papst rief dazu auf, „das kostbare Geschenk der Meinungs- und Pressefreiheit zu schützen“ – ein Appell, der mit lautem Applaus beantwortet wurde.
Der Frieden beginnt in der Sprache
Besondere Aufmerksamkeit widmete Leo XIV. der Rolle der Kommunikation in einer polarisierten Welt. Es gehe um mehr als nur sachliche Berichterstattung: „Um Frieden zu ermöglichen, ist eine andere Art der Kommunikation erforderlich“, sagte er. Eine, die sich nicht von Aggression, Sensationslust oder Konkurrenzdenken leiten lasse.
„Wir müssen 'Nein' sagen zum Krieg der Worte und Bilder, wir müssen das Paradigma des Krieges ablehnen.“ Kommunikation müsse sich an Wahrheit und Liebe orientieren – zwei Begriffe, die für den Papst untrennbar verbunden sind. Frieden beginne, so Leo XIV., „in der Art, wie wir andere ansehen, ihnen zuhören und über sie sprechen“.
Jenseits von Klischees: Medien und Kirche
Auch den Blick der Medien auf die Kirche nahm der Papst in den Fokus. Die Berichterstattung solle frei von Stereotypen sein: „Vielen Dank für Ihren Beitrag, um über Klischees hinauszugehen, durch die wir oft das christliche Leben und das Leben der Kirche interpretieren.“
Gleichzeitig wies er auf eine der großen Herausforderungen unserer Zeit hin – den verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Deren „immenses Potenzial“ müsse „zum Wohle aller und im Dienst der Menschheit“ genutzt werden.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Weißer Rauch über Rom, Glockengeläut in Wien
Am Abend des 8. Mai 2025 blickte die Welt erwartungsvoll zum Schornstein der Sixtinischen Kapelle – und Österreich lauschte dem Klang seiner Kirchenglocken. Um Punkt 18.15 Uhr setzte die ehrwürdige Pummerin im Wiener Stephansdom ein. Ihr mächtiger Ton hallte 15 Minuten lang durch die Hauptstadt und kündete vom Ende der Sedisvakanz: Ein neuer Papst war gewählt.
Die Österreichische Bischofskonferenz hatte angeordnet, dass mit dem Aufstieg des weißen Rauchs alle Glocken des Landes erklingen – nicht nur als Zeichen der Freude, sondern auch als spiritueller Auftakt. Schon in den kommenden Gottesdiensten wird der neue Name in das Hochgebet aufgenommen – ein symbolischer Akt, der die weltweite Verbundenheit mit dem neuen Nachfolger Petri unterstreicht. Auch bei der Amtseinführung werden die Glocken erneut rufen, begleitet von gelb-weißen Fahnen an kirchlichen Gebäuden.
Leo XIV.: Der erste Papst aus den USA
Mit der Wahl von Kardinal Robert Francis Prevost zu Papst Leo XIV. hat das Konklave Geschichte geschrieben: Er ist der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri. Der 69-Jährige, zuletzt Präfekt des einflussreichen Bischofsdikasteriums, bringt nicht nur verwaltungstechnische Expertise, sondern auch seelsorgerische Tiefe mit – gewachsen in Jahrzehnten weltkirchlicher Erfahrung zwischen Chicago, Rom und Peru.
Geboren 1955 in Chicago, geprägt von französisch-italienischen und spanischen Wurzeln, trat Prevost nach seinem Mathematikstudium dem Augustinerorden bei. Früh zeigte sich seine akademische Begabung: Ein Doktorat in Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität Heiliger Thomas von Aquin markierte den Anfang seiner theologischen Karriere. Doch statt in einer Kurienlaufbahn zu verharren, wählte er zunächst den Weg des Missionars – nach Peru, ein Land, das ihn tief prägte und dessen Staatsbürgerschaft er seit 2015 ebenfalls trägt.
Ein Mann des Dialogs mit pastoraler Tiefe
In Peru lehrte und leitete Prevost über Jahre hinweg das Augustinerseminar in Trujillo, war Kanzler, Gerichtsvikar und Gemeindeseelsorger – ein vielseitiger Hirte, nah bei den Menschen. 1998 kehrte er in die USA zurück und wurde Provinzial der Augustiner, 2001 schließlich zum Generalprior in Rom gewählt. Diese Rolle übte er über zwei Amtszeiten hinweg aus – global vernetzt und geschätzt.
Ab 2014 begann dann sein steiler Aufstieg in die Bischofshierarchie: erst Apostolischer Administrator, dann Bischof von Chiclayo, schließlich Kardinal mit Schlüsselaufgaben in der Bischofskongregation. 2023 wurde er von Papst Franziskus zum Präfekten des reformierten Bischofsdikasteriums ernannt – ein Posten, der ihn zu einem der zentralen Akteure der Weltkirche machte.
Mit seiner Vielsprachigkeit – Prevost spricht neben Englisch auch Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch sowie Grundkenntnisse in Deutsch – und seiner interkontinentalen Biografie verkörpert Leo XIV. eine Kirche im Dialog mit den Kulturen.
Ein neues Pontifikat mit vertrauten Tönen
In Wien war Prevost zuletzt im November 2024 zu Gast. In der Augustinerkirche feierte er den 675. Weihetag des Gotteshauses – ein Ort, der wie der neue Papst selbst für Verwurzelung in Tradition und Offenheit für die Zukunft steht.
Sein bischöflicher Wahlspruch – "nos multi in illo uno unum" ("In diesem einen [Christus] sind wir vielen eins") – gibt programmatisch Ausblick auf sein Pontifikat: Einheit in Vielfalt. Auch der synodale Weg seines Vorgängers dürfte unter ihm fortgeführt werden. Papst Franziskus hatte vor seinem Tod die nächste große Kirchenversammlung für Oktober 2028 anberaumt. Vieles spricht dafür, dass Leo XIV. diesen Reformkurs mit kluger Hand weiterträgt.
Ein Papst des 21. Jahrhunderts
Papst Leo XIV. tritt sein Amt in einer Zeit an, in der die katholische Kirche Antworten auf globale Herausforderungen geben muss – auf soziale Ungleichheit, Migration, Missbrauch, Umweltkrisen und Glaubensverlust. Seine Biografie vereint dafür das Notwendige: Welterfahrung, geistliche Tiefe, strukturelle Kompetenz – und eine glaubwürdige Nähe zu den Menschen.
Die Kirche hat mit Leo XIV. einen Papst gewählt, der Brücken bauen kann – zwischen Kontinenten, Kulturen und kirchlichen Lagern. Es ist ein historischer Moment. Und ein hoffnungsvoller.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen Papst. In der Sixtinischen Kapelle, wo seit Jahrhunderten die Wahl des Nachfolgers Petri stattfindet, haben sich die Kardinäle im vierten Wahlgang geeinigt. Der Petersdom antwortete unmittelbar mit feierlichem Glockengeläut, das sich wie ein Siegeschoral über die Ewige Stadt legte.
Der Petersplatz, schon seit Stunden von erwartungsvollen Pilgern, Gläubigen und Neugierigen gefüllt, wurde im Nu zum Schauplatz einer kollektiven, weltumspannenden Freude. Menschen umarmten sich, viele mit Tränen des Glücks in den Augen, als die ersten „Viva il Papa!“-Rufe die Stille durchbrachen. Kameras klickten, Reporter übertrugen live, als die Glocken der Stadt zu einem Festgeläut anschwollen, das Rom erbeben ließ.
Noch ist der Name des neuen Pontifex nicht verkündet – doch das wird sich bald ändern. Der Kardinalprotodiakon, Dominique Mamberti, wird in Kürze auf den berühmten Mittelbalkon der Basilika treten, um die Worte zu sprechen, auf die die Welt wartet: „Annuntio vobis gaudium magnum – Habemus Papam!“. Es ist ein Ruf, der weit über die Mauern des Vatikans hinaus hallt – ein Ruf der Hoffnung, des Aufbruchs und der spirituellen Erneuerung.
Zuvor jedoch hat sich der Erwählte zurückgezogen in den sogenannten „Raum der Tränen“, einen Ort des inneren Aufbruchs, wo der neue Papst allein die weißen Gewänder seines Amtes anlegt. Dort, fern von den Blicken der Öffentlichkeit, darf er der überwältigenden Last und Gnade dieses Moments freien Lauf lassen. Anschließend werden ihm die Kardinäle Gehorsam und Treue schwören – ein symbolischer Akt tiefster Einigkeit.
Das Konklave selbst begann erst am Mittwoch und zählt damit zu den kürzesten in der Kirchengeschichte. 133 wahlberechtigte Kardinäle aus aller Welt hatten sich – abgeschottet von der Welt – beraten, gebetet und gewählt. Die Sedisvakanz, die Zeit der Leere seit dem Tod von Papst Franziskus am 21. April, findet damit ihr feierliches Ende.
Franziskus, der Papst der Armen, der Reformer mit sanfter Stimme und fester Haltung, hatte tiefe Spuren hinterlassen. Sein Verzicht auf Prunk, seine Nähe zu den Menschen und seine mutigen Stellungnahmen zu globalen Themen machten ihn zum moralischen Kompass unserer Zeit. Er fand seine letzte Ruhe nicht im Petersdom, sondern in der Marienkirche Santa Maria Maggiore – seinem Herzensort.
Nun aber richtet sich der Blick auf das Fenster der Weltkirche, wo sich bald der 267. Nachfolger des Apostels Petrus zeigen wird. Er wird segnen – Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis – und damit ein neues Kapitel im Buch des Glaubens aufschlagen.
Quelle: orf.at und kathpress, redigiert durch ÖA
Schwarzer Rauch, stille Zeichen
Es war genau 11:51 Uhr, als ein aufmerksamer Blick gen Himmel ausreichte, um den Verlauf des Vormittags im Vatikan zu deuten: Schwarzer Rauch stieg erneut aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle empor – ein unmissverständliches Zeichen, dass auch der zweite Tag der Papstwahl ohne Einigung blieb. Damit sind nun bereits drei Wahlgänge verstrichen, ohne dass sich eine Zweidrittelmehrheit unter den 133 wahlberechtigten Kardinälen gebildet hat.
Die Szenerie auf dem Petersplatz wiederholte sich – und doch lag eine eigentümliche Spannung in der Luft. Tausende Gläubige, Touristen und Römer hatten sich erneut versammelt, um der nüchternen, fast alchemistischen Choreographie des Konklaves beizuwohnen. Der Rauch aus dem antiken Schornstein wurde zum flüchtigen, aber gewichtigen Boten einer Weltkirche, die nach neuer Führung sucht.
Ein Warten mit Geschichte
Seit dem frühen Donnerstagmorgen sind die Kardinäle im Inneren der Sixtina zurückgezogen – abgeschirmt von der Welt, der Kommunikation enthoben, dem sakralen Ernst der Wahl verpflichtet. Die Nachfolge von Papst Franziskus, der am 21. April verstorben ist, gestaltet sich als komplexes Ringen. 89 Stimmen wären nötig, um einen neuen Pontifex zu bestimmen – bislang jedoch vergeblich.
Das abendliche Ritual wiederholte sich bereits am Vortag: gegen 21 Uhr stieg ebenfalls dunkler Rauch auf. Doch das Scheitern des Konsenses bedeutet nicht Stillstand – im Gegenteil. Der Prozess der Wahl ist ein Werk der Besinnung, des Gebets und der diplomatischen Feinfühligkeit innerhalb eines Gremiums, das aus über hundert Nationen zusammenkommt.
Rauch, Ritual und Rückzug
In den Gemäuern der Sixtinischen Kapelle brennen während der Wahl zwei Öfen: einer historischen Herkunft, eingeführt 1939, für die Verbrennung der Stimmzettel; ein zweiter, moderner, beigemischt mit chemischen Zusätzen, um die Rauchfarbe zu beeinflussen. Das visuelle Signal, das seit Jahrhunderten dem wartenden Volk vermittelt, ob ein neuer Hirte gefunden wurde, bleibt ein einzigartiges Merkmal dieses uralten Rituals – obwohl es nicht einmal formell vorgeschrieben ist.
Die Wahlordnung der Kirche erlaubt pro Tag vier Wahlgänge, jeweils zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Falls es auch am heutigen Nachmittag zu keiner Entscheidung kommt, wird sich erneut schwarzer Rauch über dem Vatikanhimmel zeigen – mutmaßlich nach 19 Uhr.
Hoffnung im Zeichen des Schweigens
Der Nachmittag bringt neue Gelegenheit für Einigung – mit Beginn der nächsten Sitzung um 16:30 Uhr. Und während sich die Türen der Kapelle ein weiteres Mal schließen, richtet sich die Aufmerksamkeit der Welt auf einen unscheinbaren Schornstein. Der nächste weiße Rauch, der aus ihm steigt, wird nicht nur das Ende einer Wahl verkünden – sondern den Anfang eines neuen Pontifikats.
Bis dahin verweilt der Petersplatz in stiller Erwartung. Die Glocken des Doms schweigen. Doch sie stehen bereit. Bereit für den Moment, in dem aus stiller Enklave wieder Stimme wird. Und Geschichte.
Quelle; kathpress, redigiert durch ÖA
In der Ewigen Stadt bereitet sich alles auf einen der bedeutendsten Momente im Leben der römisch-katholischen Kirche vor: die Wahl des neuen Papstes. Mit dem feierlichen Einzug der Kardinäle in die Sixtinische Kapelle beginnt am Mittwochabend das Konklave, dessen Ausgang weltweit mit Spannung erwartet wird.
Bereits am Dienstag bezogen die 133 wahlberechtigten Kardinäle ihre Quartiere im Gästehaus Santa Marta – dem temporären Zentrum geistlicher Reflexion und geheimer Beratungen. Den Auftakt zur Wahl bildet eine Messe im Petersdom am Mittwochmorgen um 10 Uhr. Um 16:30 Uhr erfolgt dann der Einzug in die Sixtina, wo voraussichtlich noch am selben Abend der erste Wahlgang abgehalten wird. Steigt weißer Rauch aus dem berühmten Schornstein, bedeutet dies: Die Kirche hat einen neuen Papst.
Sollte es nicht gleich zu einer Einigung kommen, werden an den folgenden Tagen bis zu vier Wahlgänge pro Tag durchgeführt. Wie Vatikansprecher Matteo Bruni erklärte, wird dann jeweils gegen 10:30 Uhr, 12:00 Uhr sowie 17:30 Uhr und 19:00 Uhr Rauch aufsteigen – weiß bei einer Wahl, schwarz bei ergebnisloser Stimmabgabe. Die Weltöffentlichkeit wird diese Zeichen vom Petersplatz aus live mitverfolgen können.
Zeit des Austauschs ist vorüber
Am Dienstagmittag endete die sogenannte Generalkongregation, das letzte große Beratungstreffen aller Kardinäle. Anwesend waren 130 der 133 Papstwähler sowie 40 nicht wahlberechtigte Kardinäle. Die Geistlichen erinnerten dabei an das geistige und strukturelle Erbe von Papst Franziskus und mahnten, dessen Reformwerk in Bereichen wie Missbrauchsaufarbeitung, Finanztransparenz, synodaler Mitbestimmung und Friedensdiplomatie fortzusetzen.
Der künftige Papst, so betonten die Kardinäle, müsse ein „Hirte der Menschlichkeit“, ein „Brückenbauer“ und „Lehrer der Barmherzigkeit“ sein – ein Führer, der inmitten weltweiter Krisen Hoffnung und Orientierung schenkt. Gleichzeitig appellierten sie an die internationale Gemeinschaft, in Konflikten wie in der Ukraine oder im Nahen Osten endlich tragfähige Friedenslösungen zu suchen.
Symbolischer Schlussakt: Der Fischerring zerbrochen
Im Rahmen der letzten Versammlung wurde ein traditionsreicher Akt vollzogen: die Zerstörung des sogenannten Fischerrings von Papst Franziskus. Der Ring, einst Siegel und Symbol päpstlicher Autorität, wurde gemäß dem päpstlichen Wahlgesetz feierlich unbrauchbar gemacht. Diese Geste markiert das endgültige Ende eines Pontifikats und bereitet den Weg für das nächste.
Schweigepflicht und Sicherheitsvorkehrungen
Rund 100 Personen, die das Konklave logistisch begleiten – darunter Köche, Reinigungspersonal, Fahrer und technisches Fachpersonal – haben am Montag unter Eid absolute Verschwiegenheit gelobt. Jeder Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten zieht die härteste kirchenrechtliche Strafe nach sich: die Exkommunikation.
Um jegliche externe Kommunikation auszuschließen, werden ab Mittwoch um 15 Uhr sämtliche Telekommunikationsverbindungen im Vatikan abgeschaltet – ein striktes Gebot des Kirchenrechts, das die Unversehrtheit und Vertraulichkeit der Papstwahl garantieren soll.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Von der stillen Sammlung bis zum weißen Rauch: Das Konklave beginnt. Ein Überblick über den Weg zur Wahl eines neuen Papstes.
Am Mittwoch versammeln sich 133 Kardinäle aus aller Welt hinter den verschlossenen Türen der Sixtinischen Kapelle. Ihr Ziel: die Wahl eines neuen Papstes. Nach Tagen intensiver Gespräche im sogenannten Vorkonklave beginnt nun der eigentliche Wahlprozess – ein Ritual von weltkirchlicher Bedeutung und geheimnisvoller Strenge. Die Nachrichtenagentur Kathpress gibt Antworten auf die drängendsten Fragen rund um diesen historischen Moment.
Wer war am Vorkonklave beteiligt?
Im Vorkonklave, das der offiziellen Wahl vorausgeht, durften alle Kardinäle mitdiskutieren – auch jene, die das 80. Lebensjahr überschritten haben. So nahm etwa auch Kardinal Christoph Schönborn aus Wien teil, obwohl er altersbedingt nicht mehr wahlberechtigt ist. Geleitet wurde die Versammlung vom hochbetagten Kardinaldekan Giovanni Battista Re. Im Zentrum der Reden standen weniger Personalfragen, sondern vielmehr die Herausforderungen der Kirche und die Erwartungen an ihren künftigen Oberhirten.
Wer darf den Papst wählen – und wer nicht?
Nur Kardinäle unter 80 Jahren sind stimmberechtigt. Von den ursprünglich 136 infrage kommenden Wahlmännern haben drei auf die Teilnahme verzichtet. Somit wird das neue Kirchenoberhaupt von 133 Kardinälen bestimmt – ein Quorum, das sowohl Weite als auch Komplexität garantiert.
Wo wohnen die Papstwähler während des Konklaves?
Die meisten Wahlkardinäle sind im Gästehaus Santa Marta untergebracht, einem schlichten, aber modernen Komplex in unmittelbarer Nähe zum Vatikan. Aufgrund begrenzter Kapazitäten wurden einige in ein älteres Nachbargebäude ausgelagert. Der Weg zur Sixtinischen Kapelle wird täglich zu Fuß oder per Shuttlebus zurückgelegt. Für die kulinarische Versorgung sorgt die Küche des Gästehauses – abgeschirmt vom Rest der Welt.
Wann beginnt das Konklave offiziell?
Der feierliche Auftakt erfolgt am Mittwochvormittag mit der Messe pro eligendo Romano Pontifice im Petersdom. Kardinal Re, der dienstälteste unter den Wahlkardinälen, wird ihr vorstehen. Nach einem stillen Mittagessen und einer Zeit der Sammlung zieht die Wahlversammlung am Nachmittag in die Sixtinische Kapelle ein. Die Leitung des Konklaves obliegt dem erfahrenen Kardinalbischof Pietro Parolin, der unter Franziskus als Staatssekretär amtierte.
Wann steigt der erste Rauch auf?
Bereits am Mittwochabend könnte sich der erste Rauch aus dem berühmten Schornstein der Sixtinischen Kapelle erheben. Nach der Vereidigung und einer geistlichen Besinnung findet der erste Wahlgang statt. Bleibt er erfolglos, wird schwarzer Rauch aufsteigen – das untrügliche Zeichen, dass noch kein Konsens erzielt wurde.
Wie viele Wahlgänge sind pro Tag möglich?
Zweimal vormittags, zweimal nachmittags – so lautet das Wahlregime. Nach jedem Doppel-Wahlgang, der zu keinem Ergebnis führt, wird erneut schwarzer Rauch sichtbar. Sobald ein Kandidat die nötige Zweidrittelmehrheit erreicht – 89 Stimmen sind erforderlich –, kündigt weißer Rauch die Entscheidung an.
Was passiert, wenn die Einigung ausbleibt?
Sollte sich nach drei vollständigen Wahltagen noch kein Kandidat durchgesetzt haben, ist eine kurze Pause vorgesehen – ein Tag des Gebets und der Reflexion. Bleibt auch danach die Wahl erfolglos, folgen maximal sieben weitere Wahlgänge, gefolgt von einer weiteren Unterbrechung. Die Geschichte zeigt: Geduld ist geboten. Die bislang längste Papstwahl des 20. Jahrhunderts dauerte fünf Tage.
Wie wird der neue Papst der Welt präsentiert?
Hat ein Kandidat die Wahl angenommen und einen Papstnamen gewählt, beginnt die feierliche Inszenierung. Der neue Papst wird eingekleidet, weiße Rauchschwaden steigen auf. Rund 45 Minuten später tritt der ranghöchste Kardinaldiakon auf den Balkon des Petersdoms. Mit den Worten Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! verkündet er die frohe Botschaft. Dann folgt der Name des neuen Kirchenoberhaupts – und dessen erste Worte als Bischof von Rom an die wartende Welt.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Zwischen Tradition und Erneuerung, Charisma und Ordnung: Kurz vor Beginn des Konklaves herrscht in der Ewigen Stadt gespannte Erwartung. Die Kardinäle tagen, beraten, horchen einander ab – und suchen das Profil des nächsten Papstes. Wer wird die Kirche durch die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts führen? Ein Blick hinter die Kulissen der mächtigsten Versammlung der katholischen Welt.
Letzte Beratungen vor dem verschlossenen Tor
In der Vatikanstadt neigt sich eine der kritischsten Phasen im Vorfeld eines Konklaves dem Ende zu. Die unter 80-jährigen Kardinäle, die allein wahlberechtigt sind, ziehen in Kürze in die Sixtinische Kapelle ein. Bis dahin jedoch laufen die Gespräche auf Hochtouren – nicht nur in offiziellen Foren, sondern auch bei vertraulichen Abendessen und informellen Runden in den vatikanischen Gärten.
Auch die älteren Kardinäle, obwohl nicht mehr stimmberechtigt, sind noch hörbar präsent. So etwa Kardinal Walter Kasper (92), der am Wochenende ein offenes Zwischenfazit zog: Noch habe keine Rede die entscheidende Richtung vorgegeben, die Wortmeldungen seien „sowohl in die eine wie in die andere Richtung“ gegangen.
Zwischen Franziskus’ Vermächtnis und neuer Lehre
Die erste große Richtungsfrage betrifft die geistige Orientierung des künftigen Pontifikats. Soll der neue Papst den Kurs von Franziskus fortsetzen – einen pastoralen, inklusiven Stil, der sich den Armen, den Ausgeschlossenen und Andersdenkenden zuwendet? Oder braucht es, wie Kardinal Gerhard Ludwig Müller es formuliert, einen Rückgriff auf einen „Kirchenlehrer“, der mit dogmatischer Klarheit für eine theologisch stringente Kirche steht?
In diesem Spannungsfeld wird unter anderem Kardinal Jean-Marc Aveline (66) aus Marseille genannt. Der französische Theologe, bekannt für seine tiefgründige Spiritualität und sein Eintreten für interreligiösen Dialog, hat mit seiner jüngsten Predigt über eine „Theologie der göttlichen Liebe“ viele Ohren geöffnet. Er gilt als möglicher Brückenbauer zwischen Herz und Lehre.
Ein anderer Name fällt häufig: Kardinal Matteo Zuppi (69), Erzbischof von Bologna und Präsident der Italienischen Bischofskonferenz. Zuppi verbindet Nähe zu den sozial Schwachen mit klaren innerkirchlichen Positionen. Seine Verwurzelung in der Gemeinschaft Sant’Egidio – bekannt für Friedensarbeit und Dialog – macht ihn für viele zum idealen Erben des franziskanischen Geistes.
Charisma oder Kanzleiverstand?
Auch in Stil- und Führungsfragen gehen die Erwartungen auseinander. Nach dem überaus volksnahen, teils unkonventionellen Auftreten von Papst Franziskus fragen sich viele, ob es nicht wieder mehr Struktur und institutionelle Klarheit brauche. Vor allem innerhalb der Kurie wird auf mehr Rechtssicherheit, Transparenz und geordnete Verfahren gedrängt.
Hier fällt oft der Name Kardinal Pietro Parolin (70), der erfahrene Staatssekretär des Vatikans. Als versierter Diplomat kennt er die globalen politischen Verflechtungen ebenso wie die innerkirchlichen Apparate. Doch es wird auch gemunkelt, dass ihm das persönliche Charisma fehlt, das in der heutigen Mediengesellschaft kaum verzichtbar scheint.
Für jene, die eine charismatische, aber auch rechtlich fundierte Persönlichkeit suchen, ist Kardinal Peter Turkson (76) aus Ghana eine Option. Der frühere Leiter des Dikasteriums für ganzheitliche Entwicklung ist international angesehen, steht für soziale Gerechtigkeit – und besitzt dennoch ein feines Gespür für das institutionelle Gefüge der Kirche.
Zwischen Synode und Hierarchie
Eine dritte Weggabelung zeigt sich in der Frage nach der innerkirchlichen Verfassung: Synodalität oder Hierarchie? Franziskus hat in seiner Amtszeit die Mitbestimmung gestärkt, etwa durch das Stimmrecht für Frauen bei der Bischofssynode. Doch das Gleichgewicht zwischen kollegialer Beratung und päpstlicher Autorität ist noch nicht gefunden.
In diesem Spannungsfeld kommt Kardinal Mario Grech (68), Generalsekretär der Weltsynode, ins Spiel. Der Kirchenrechtler aus Malta hat sich einen Namen gemacht, indem er kontroverse Themen wie die Rolle der Frau in der Kirche in geordnete synodale Prozesse überführte, ohne vorschnelle Entscheidungen zu forcieren. Seine ruhige Hand gilt vielen als Hoffnung für eine verfassungspolitisch stabile Weiterentwicklung.
Auch der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich (66) wird genannt. Als Generalrelator der Weltsynode und Erzbischof in einem säkular geprägten Land hat er Erfahrung im Umgang mit einer pluralen, kritischen Öffentlichkeit – und steht für einen weltoffenen Katholizismus mit europäischem Profil.
Das Puzzle bleibt unvollständig
Zwei Tage vor der Schließung der Türen der Sixtinischen Kapelle ist das Feld der Kandidaten weit offen – vielleicht weiter denn je. Keiner hat bisher jene breite Zustimmung gefunden, die es für die Zweidrittelmehrheit braucht. Viele Kardinäle suchen nach einer Synthese: zwischen pastoraler Nähe und dogmatischer Klarheit, zwischen Charisma und Verwaltungsstärke, zwischen synodalem Geist und traditioneller Verankerung.
Das nächste Pontifikat steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die Kirche braucht mehr als ein Gesicht – sie braucht einen Hirten mit Vision, Mut und Bindungskraft. Ob er aus Europa, Afrika oder Lateinamerika stammt, ob bekannt oder bislang unterschätzt – eines ist sicher: Die Welt blickt nach Rom. Und das künftige Gesicht der katholischen Kirche wird dort in stiller Abstimmung geboren.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Mit einem emotionalen Auftritt hat Papst Franziskus am Sonntag für ein kraftvolles Lebenszeichen gesorgt – und nach Meinung seines behandelnden Arztes ein bemerkenswertes Comeback hingelegt. Der überraschende öffentliche Auftritt des Pontifex, der erst vor wenigen Wochen in kritischem Zustand im Krankenhaus lag, hat weit über den Vatikan hinaus für Aufsehen gesorgt.
„Ein besseres Comeback hätte er nicht haben können“
Professor Sergio Alfieri, Chefarzt der Gemelli-Klinik in Rom und langjähriger medizinischer Begleiter des Papstes, zeigte sich im Gespräch mit der italienischen Tageszeitung Il Messaggero tief beeindruckt. „Lebhaft, präsent, gut gelaunt – es ist tröstlich, ihn so zu sehen“, sagte der Mediziner. Franziskus sei nicht länger ein schwerkranker Patient, sondern ein Mensch auf dem Weg der Besserung. „Jetzt ist er wieder er selbst – Papst Franziskus“, betonte Alfieri. „Ein besseres Comeback hätte er nicht haben können.“
Ein Papst, der sich nicht versteckt
Rund 20.000 Gläubige waren Zeugen des Auftritts auf dem Petersplatz im Rahmen des Heiligen Jahres für Kranke und medizinisches Personal. Im Rollstuhl sitzend, mit Sauerstoffkanülen und brüchiger Stimme, spendete der Papst seinen Segen – sichtlich geschwächt, aber voller Zuversicht. „Schon am Samstag wollte er hinaus zu den Menschen“, verriet Alfieri. „Er ist wieder aktiv, manchmal muss man ihn sogar bremsen.“
Besonders bemerkenswert: Die Entscheidung, sichtbar mit den Sauerstoffkanülen aufzutreten, traf Franziskus ganz bewusst. „Er hätte sie auch weglassen können, aber er wollte seine Gebrechlichkeit nicht verbergen“, so Alfieri. Der Papst habe dies gemeinsam mit seinem medizinischen Assistenten Massimiliano Strappetti entschieden – eine bewusste Botschaft der Transparenz und Ehrlichkeit.
Zwischen Geduld und Papstsein
Trotz des positiven Fortschritts bleibt das Ärzteteam wachsam. Sechs Wochen Erholungszeit wurden Franziskus verordnet – eine Herausforderung für den ungeduldigen Papst. „Es wird ein Tauziehen geben zwischen ihm, der wieder unter sein Volk will, und uns Ärzten“, sagte Alfieri schmunzelnd.
„Der Papst ist zurück – und er überrascht gern“
Für den Chefarzt steht fest: Der Auftritt war mehr als ein symbolischer Akt. „Er wollte beim Tag für Kranke dabei sein – nicht als Patient, sondern als Genesender“, sagte Alfieri. Und er schloss mit einem vielsagenden Hinweis: „Ich schließe weitere Überraschungen nicht aus. Er ist der Papst – und er entscheidet.“
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Empfehlungen
„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen
Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen
Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen
13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen
66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen
24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen
Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen
Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen
65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen
Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen
Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen
Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen
"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen
HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen
Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen
Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen
Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen
Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen
Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen
Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen
Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen
Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen
Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen
Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen
Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen
Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen
Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen
Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen
Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen
25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen
Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen
Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen