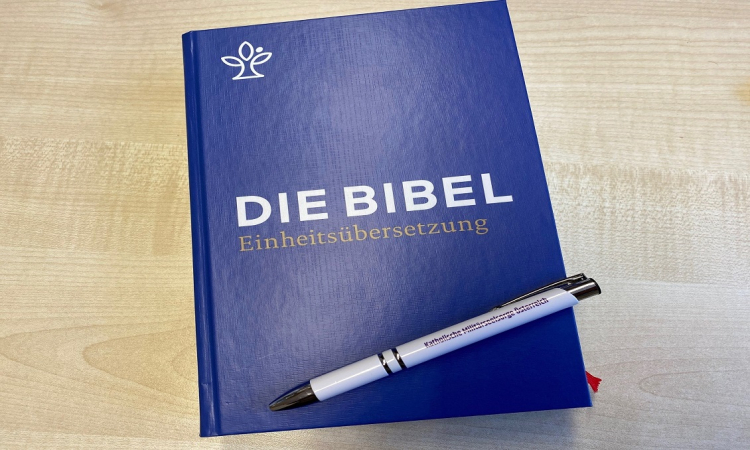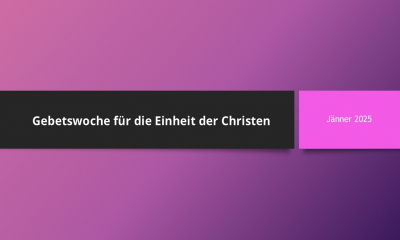Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Am 27. Januar 2025 jährt sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee zum 80. Mal. In einer Zeit, in der Antisemitismus und Populismus weltweit zunehmen, sendet die Gedenkveranstaltung eine unmissverständliche Botschaft: Nie wieder.
Ein Gedenktag mit besonderer Bedeutung
Die Veranstaltung, zu der zahlreiche Staatsoberhäupter, Delegationen und Organisationen erwartet werden, setzt laut Manfred Deselaers, deutscher Auschwitz-Seelsorger, einen „deutlichen Gegenakzent“ zu den aktuellen globalen Entwicklungen. „Es ist ein Zeichen gegen wachsenden Antisemitismus und die zunehmende Abgrenzung“, so Deselaers. Angesichts des hohen Alters der letzten Überlebenden gewinnt der Jahrestag zusätzliche Dringlichkeit: „Die Generation der direkten Zeitzeugen geht zu Ende.“
Seit 1990 lebt und arbeitet Deselaers in Oswiecim, wie Auschwitz auf Polnisch heißt. Für sein Engagement im Zentrum für Dialog und Gebet wurde er mehrfach ausgezeichnet. Sein Appell ist eindeutig: „Das Erinnern muss weiterleben, auch wenn die Stimmen der Überlebenden verstummen.“
Der Holocaust und die nationale Erinnerung
Auschwitz, das Symbol für die Shoa, ist ein Ort des Grauens und der Mahnung. Mehr als eine Million Menschen wurden dort ermordet, darunter überwältigend viele Juden sowie Sinti und Roma, Homosexuelle, politische Gefangene und Kriegsgefangene. In Polen ist Auschwitz nicht nur mit dem Holocaust, sondern auch mit dem eigenen nationalen Leid verbunden. Piotr Cywinski, Direktor des Museums und der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, betont: „Es ist ein Ort, an dem die Deutschen nicht nur 300.000 polnische Juden, sondern auch 150.000 Polen deportierten.“
Cywinski kritisiert die Verwendung des Begriffs „polnische Todeslager“, der gelegentlich international auftaucht, als geschichtsverfälschend. „Das ist, als würde man die Hiroshima-Bombe als japanisch bezeichnen. Diese Lager waren deutsche Lager.“
Erinnerungskulturen: Deutschland und Polen im Vergleich
Während Auschwitz in Polen tief im kollektiven Gedächtnis verankert ist, wird der Holocaust in Deutschland oft als Verbrechen gegen die jüdische Bevölkerung wahrgenommen. In Polen hingegen ist Auschwitz ein doppeltes Symbol: Es steht für den Holocaust und den größten Friedhof des Landes.
Die Unterschiede in der Erinnerungskultur sind spürbar. In einer Umfrage des Jahres 2022 gaben Deutsche an, Frankreich stärker mit dem Zweiten Weltkrieg zu assoziieren als Polen. Auch in der Gedenkkultur liegt die Normandie oft vor Auschwitz.
Cywinski sieht die Unterschiede jedoch nicht als Widerspruch. Vielmehr betont er die Notwendigkeit der ständigen Arbeit am Gedächtnis: „Das Gedächtnis dient dazu, dass wir heute klüger sind, und nicht nur, um die Opfer von damals zu betrauern. Wir brauchen diese Erinnerung heute.“
Kein Platz für politische Instrumentalisierung
In diesem Jahr wird die Gedenkfeier erstmals ohne offizielle russische Vertreter stattfinden – ein Umstand, der durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine bedingt ist. Für Deselaers ist das „tragisch, aber politisch wohl notwendig“. Bis vor dem Krieg war die russische Präsenz bei den Feiern selbstverständlich, schließlich war es die Rote Armee, die Auschwitz befreite. Ob und wann russische Vertreter wieder teilnehmen werden, bleibt offen.
„Nie wieder“: Ein globales Erbe
Die Veranstaltung in Auschwitz steht nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft. „Hitler brauchte sechs Jahre, um den Krieg zu beginnen – und er hatte keine sozialen Medien“, mahnt Cywinski. In einer Zeit, in der Populismus und Nationalismus neue Höhen erreichen, ist die Lehre von Auschwitz aktueller denn je.
Die Botschaft der Überlebenden, Politiker und Gedenkstättenleiter bleibt klar: Nie wieder. Auschwitz ist ein Mahnmal gegen das Vergessen – und gegen das Wiederholen solcher Verbrechen. „Wir sind es, die die Erinnerung brauchen“, sagt Cywinski. Ein Satz, der angesichts des Gedenktages mehr Nachdruck kaum haben könnte.
Quelle: kathpress, KZ Auschwitz: Gedenken zum 80. Jahrestag der Befreiung - ZDFheute. Redigiert durch ÖA
Am Bibelsonntag rief Papst Franziskus dazu auf, trotz der Herausforderungen in der Welt auf Gottes Heilsversprechen zu vertrauen. Er betonte die unveränderliche Hoffnung, die das Evangelium schenkt.
Ein lebendiges und verlässliches Wort
Papst Franziskus hat die Gläubigen ermutigt, angesichts von Kriegen, Leid und Ungerechtigkeit nicht den Glauben an Gottes Plan für die Menschheit zu verlieren. In einer bewegenden Predigt am Bibelsonntag im Petersdom erklärte er:
"Das Heil, das Gott uns schenkt, ist noch nicht vollständig verwirklicht. Doch Kriege, Ungerechtigkeit, Leid und Tod werden nicht das letzte Wort haben, denn das Evangelium ist ein lebendiges und verlässliches Wort, das niemals enttäuscht."
Seine Worte, getragen von der Botschaft der Hoffnung, richteten sich an alle Christen, die inmitten der Herausforderungen des Lebens nach Halt suchen.
Die junge Tradition des Bibelsonntags
Der Bibelsonntag wurde von Papst Franziskus im Jahr 2019 mit dem Apostolischen Schreiben "Aperuit Illis" eingeführt und 2020 erstmals gefeiert. Ziel ist es, die Bibel stärker in den Fokus des kirchlichen Lebens zu rücken. Seitdem findet dieser besondere Sonntag jährlich am letzten Wochenende im Januar statt und lädt zur Feier, Betrachtung und Verbreitung des Wortes Gottes ein.
In Österreich ist der Bibelsonntag Teil der Bibelwoche, die in diesem Jahr vom 19. bis 26. Januar stattfand. Die Initiative wird nicht nur in Gottesdiensten, sondern auch durch Bibelkreise und Veranstaltungen begleitet, die Gläubige dazu ermutigen, sich mit der Heiligen Schrift intensiver auseinanderzusetzen.
"Die Welt nach Gottes Willen verwandeln"
In seiner Predigt betonte Papst Franziskus die zentrale Rolle der Bibel im Leben der Christen:
"Die gesamte Bibel erinnert an Christus und sein Werk, und der Geist vergegenwärtigt es in unserem Leben und in der Geschichte."
Er rief dazu auf, das Evangelium überall zu verkünden und betonte die transformative Kraft des Glaubens: "Die Christen sind aufgerufen, die Welt nach dem Willen Gottes zu verwandeln, der sie aus Liebe geschaffen und erlöst hat."
Neue Lektoren für den Dienst am Wort Gottes
Ein weiterer Höhepunkt des Gottesdienstes war die Beauftragung von 40 Frauen und Männern aus verschiedenen Ländern zum Lektorendienst. Fünf von ihnen kamen aus Österreich. Diese neu ernannten Lektoren werden künftig in der Liturgie Bibeltexte vorlesen und damit das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen.
Franziskus zeigt sich volksnah
Trotz eines vollen Terminkalenders im Januar zeigte sich der Papst in guter gesundheitlicher Verfassung. Nach der Messe begrüßte er im Rollstuhl zahlreiche Gläubige und Gruppen von Pilgern persönlich. Seine Nähe und Herzlichkeit wurden von den Anwesenden spürbar geschätzt.
Hoffnung in herausfordernden Zeiten
Der Bibelsonntag erinnert daran, dass das Wort Gottes eine Quelle der Hoffnung und Stärke ist – gerade in Zeiten von Unsicherheit und Leid. Papst Franziskus betonte eindrücklich, dass das Evangelium eine unerschütterliche Zusage Gottes für die Menschheit ist: "Es enttäuscht niemals."
Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA
Schönborn tritt zurück: Josef Grünwidl als Apostolischer Administrator der Erzdiözese Wien ernannt
Papst Franziskus akzeptiert Rücktritt des Wiener Erzbischofs
Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch von Kardinal Christoph Schönborn pünktlich zu dessen 80. Geburtstag angenommen. Mit Wirkung vom 22. Januar 2025 ist Schönborn offiziell emeritierter Erzbischof von Wien. Zugleich ernannte der Papst den bisherigen Bischofsvikar Josef Grünwidl zum Apostolischen Administrator der Erzdiözese Wien. Diese Entscheidungen wurden am Mittwoch vom Vatikan im "Bollettino" und von der Erzdiözese Wien bestätigt.
Interimslösung bis zur Wahl eines Nachfolgers
Mit der Ernennung Grünwidls wird die Erzdiözese Wien vorerst durch eine Interimslösung geleitet. Als Apostolischer Administrator verwaltet Grünwidl die Diözese, ohne dabei wesentliche Entscheidungen zu treffen, die den künftigen Erzbischof binden könnten. „Dass Rom eine Übergangslösung geschaffen hat, zeigt, dass Papst Franziskus offenbar noch keine Entscheidung für einen Nachfolger getroffen hat“, erklärte der Pressesprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller. Er zeigte sich jedoch optimistisch, dass eine Entscheidung in den kommenden Wochen fallen könnte.
Schönborns Rückzug: Neue Lebensstationen
Kardinal Schönborn plant, seinen Lebensabend in einem Kloster der Schwestern vom Lamm im 20. Wiener Bezirk zu verbringen. Zudem hat er in Retz, Niederösterreich, eine Wohnung bezogen. Obwohl emeritiert, bleibt Schönborn weiterhin Ordinarius für die Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich und bekleidet zwei zentrale Positionen in Rom: Er ist Mitglied der Kardinalskommission der Vatikanbank IOR und präsidiert seit Oktober über deren Aufsichtskommission. Darüber hinaus wirkt er im Dikasterium für die Orientalischen Kirchen mit.
Eine prägende Amtszeit von fast drei Jahrzehnten
Mit mehr als 29 Jahren Amtszeit zählt Christoph Schönborn zu den längstdienenden Erzbischöfen Wiens. Er war der 32. Bischof der Erzdiözese und liegt in der historischen Rangliste der Amtszeiten auf Platz fünf. Nur Kardinal Christoph Anton Migazzi, der von 1757 bis 1803 amtierte, war mit 46 Jahren deutlich länger im Amt.
Der neue Administrator
Josef GrünwidlJosef Grünwidl, geboren am 31. Januar 1963 in Hollabrunn, Niederösterreich, bringt eine beeindruckende kirchliche Laufbahn mit. Nach seiner Matura am Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn trat er in das Wiener Priesterseminar ein. Parallel zu seinem Theologiestudium absolvierte Grünwidl ein Konzertfachstudium in Orgel an der Musikuniversität Wien. Doch bald entschied er sich klar für den Weg des Priesters. 1988 wurde er von Kardinal Franz König zum Priester geweiht.
Von der Jugendseelsorge bis zum Bischofsvikar
Nach Stationen als Kaplan und Jugendseelsorger wurde Grünwidl 1995 Sekretär des frisch ernannten Wiener Erzbischofs Schönborn. Es folgten Pfarrämter in Kirchberg am Wechsel und Perchtoldsdorf sowie die Tätigkeit als Dechant und geschäftsführender Vorsitzender des Wiener Priesterrats. Im Januar 2023 ernannte ihn Schönborn zum Bischofsvikar für das Vikariat Süd. Seit November 2024 ist Grünwidl zudem Ehrenkanoniker des Domkapitels St. Stephan.
Würdigung durch SchönbornIn einer Videobotschaft bedankte sich Kardinal Schönborn bei allen Menschen der Erzdiözese: „Ich habe vor allem Gott und Ihnen allen zu danken. Kirche geht nur miteinander, Gesellschaft geht nur miteinander.“ Er betonte die Wichtigkeit der Gemeinschaft und würdigte Grünwidl als langjährigen Freund: „Er war ein ausgezeichneter Sekretär und ein hervorragender Seelsorger. Ich bitte alle, für Administrator Josef Grünwidl zu beten.“
Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA
Mit seinem 80. Geburtstag endet die Ära von Kardinal Christoph Schönborn als Erzbischof von Wien. Die vergangenen Jahrzehnte waren geprägt von Krisen, Reformen und der Suche nach Wegen, die katholische Kirche in Österreich und weltweit in turbulenten Zeiten zu leiten. Schönborns Leben und Wirken zeichnen sich durch seinen unermüdlichen Einsatz für Dialog, Aufarbeitung und den Glauben aus.
Vom Theologen zum Krisenmanager
Als Christoph Schönborn 1995 zum Erzbischof von Wien ernannt wurde, befand sich die katholische Kirche in Österreich in einer ihrer schwersten Krisen. Sein Vorgänger, Kardinal Hans Hermann Groer, war in einen Missbrauchsskandal verwickelt, der die Glaubwürdigkeit der Kirche schwer erschütterte. Schönborns erste Reaktion, die Vorwürfe als "diffamierende Beschuldigungen" abzutun, brachte ihm Kritik ein. Doch bald gestand er seine Fehleinschätzung ein – ein frühes Zeichen seiner Fähigkeit zur Selbstkritik, die sein Amt prägen sollte.
Der Missbrauchsskandal um Groer markierte den Beginn eines Jahrzehnte währenden Engagements Schönborns für die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Er richtete 2010 eine unabhängige Opferschutzkommission ein und bat öffentlich um Vergebung. Seine Maßnahmen fanden internationale Beachtung und setzten Standards, die später auch im Vatikan übernommen wurden.
Reformwillen und Widerstände
Schönborn war ein Mann des Dialogs, aber auch der Grenzen. Als 1995 das Kirchenvolksbegehren in Österreich mehr Mitspracherechte für Laien, die Freistellung des Zölibats und mehr Rechte für Frauen forderte, reagierte er mit einem "Dialog für Österreich". Kritiker warfen ihm jedoch vor, dass der Dialog eher symbolisch blieb. Besonders deutlich zeigte sich sein konservativer Kurs, als er Helmut Schüller, einen prominenten Fürsprecher des Volksbegehrens, als Generalvikar absetzte.
Sein diözesanes Reformprojekt „APG 2010“, das eine Zusammenlegung von Pfarren und eine missionarische Erneuerung vorsah, zeigte Schönborns Bemühungen um strukturelle Anpassungen. Doch trotz aller Reformansätze blieb der gewünschte Erfolg aus: Die Kirchenaustritte nahmen weiterhin zu.
Ein Vorreiter der Aufarbeitung
2010 brachte eine neue Welle von Missbrauchsfällen die Kirche erneut in Bedrängnis. Schönborn handelte entschlossen. Mit Transparenz und Empathie wurde er zu einem Vorreiter der Aufarbeitung. Besonders symbolisch war sein öffentlich übertragenes Gespräch mit der Betroffenen Doris Reisinger 2019, in dem er sie mit den Worten „Ja, ich glaube Ihnen“ unterstützte. Diese Geste machte ihn zu einer glaubwürdigen Stimme für Opfer kirchlicher Gewalt.
Ein Kardinal der Weltkirche
Neben seinem Wirken in Österreich spielte Schönborn eine bedeutende Rolle in der Weltkirche. Als enger Vertrauter von Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus prägte er die Kirche über Jahrzehnte hinweg. Seine Sprachgewandtheit und theologischen Fähigkeiten machten ihn zu einem gefragten Berater in Rom. Besonders hervorgehoben wurde sein Beitrag zur Synode über die Familie, deren Ergebnisse er mit dem Schreiben „Amoris Laetitia“ der Weltöffentlichkeit präsentierte.
Schönborns internationales Engagement reichte weit über die Kirche hinaus. Er war eine wichtige Stimme im christlich-jüdischen Dialog und suchte den Austausch mit dem Islam, unter anderem bei einem Iran-Besuch 2001.
Die Spannung zwischen Prinzipien und Praxis
Kritik blieb Schönborn nicht erspart. Sein Umgang mit Themen wie geschiedenen Wiederverheirateten brachte ihm den Vorwurf der Heuchelei ein. Doch Schönborn sah das Leben der Kirche als Balanceakt: „Man muss die Prinzipien so hochhalten, dass man gut unten durchkommt“, sagte er 2013 in einem Interview. Für ihn gehörten Scheitern und Barmherzigkeit untrennbar zum christlichen Leben.
Erbe und Ausblick
Christoph Schönborn hinterlässt eine gespaltene Bilanz: Einerseits wurde er als Vermittler und Krisenmanager geschätzt, andererseits kritisierten viele seine Zurückhaltung bei grundlegenden Reformen. Dennoch bleibt sein Einfluss unbestritten. Als Vertrauter von drei Päpsten und Teilnehmer an neun Weltbischofssynoden prägte er die katholische Kirche auf globaler Ebene.
Sein Rückblick auf das eigene Leben ist von Demut geprägt: „Ich verdanke der Kirche unglaublich viel, sehe aber auch ihre Fehler – an mir selbst.“ Dieser Satz spiegelt das Spannungsfeld wider, in dem Schönborn stets agierte: zwischen Ideal und Realität, zwischen Prinzipien und menschlichem Scheitern.
Mit dem Ende seiner Amtszeit geht eine Ära zu Ende, die die katholische Kirche in Österreich und darüber hinaus nachhaltig geprägt hat.
Quellen: APA, Kathpress, Domradio.de, redigiert durch ÖA
Herkunft und Jugend
Die heilige Agnes stammte aus einer römischen Adelsfamilie und lebte in einer Zeit, als Christenverfolgungen unter den Kaisern Valerian oder Diokletian an der Tagesordnung waren. Bereits als junges Mädchen zeichnete sich Agnes durch außergewöhnliche Glaubensstärke aus. Im Alter von zwölf oder dreizehn Jahren widerstand sie der Werbung des Sohnes des römischen Präfekten, da sie sich in einem spirituellen Gelübde Jesus Christus versprochen hatte.
Prozess und Verfolgung
Agnes wurde vor Gericht gestellt, wo sie unbeirrt an ihrem Glauben und ihrer Entscheidung festhielt. Da das römische Recht die Hinrichtung von Jungfrauen verbot, befahl man, sie zu entkleiden und der Schande der Vergewaltigung auszusetzen. Doch der Legende nach wurde ihr Körper durch ihr langes Haar bedeckt und ein wundersames Licht erstrahlte um sie herum. Als der Sohn des Präfekten versuchte, sie zu entehren, wurde er von einem bösen Geist getötet. Agnes' Gebet brachte ihn jedoch ins Leben zurück, was zu weiteren Anklagen gegen sie führte.
Martyrium und Tod
Der Präfekt, der sich dem Urteil nicht stellen wollte, verließ Rom, und ein anderer Richter ließ Agnes auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Doch die Flammen wichen von ihr zurück. Schließlich wurde sie mit einem Schwert enthauptet, wie es bei der Schlachtung von Lämmern üblich war. Diese Darstellung führte zur ikonografischen Verbindung von Agnes mit einem Lamm, ein Symbol für Reinheit und Opferbereitschaft.
Verehrung und Relikte
Agnes' Märtyrium fand vermutlich im Circus Agonalis, dem Stadion Kaiser Domitians, statt. Über dieser Stelle wurde später die prächtige Basilika Sant'Agnese in Agone an der Piazza Navona errichtet. Ihre Reliquien ruhen in der Kirche Sant'Agnese fuori le mura, die über den Katakomben an der Via Nomentana erbaut wurde. Diese Kirche, die von Papst Honorius zwischen 625 und 630 errichtet wurde, beherbergt auch einen Silberschrein mit ihren Gebeinen.
Religiöse Bedeutung und Brauchtum
Agnes wird in der römisch-katholischen, orthodoxen, anglikanischen und amerikanisch-lutherischen Kirche am 21. Januar als Heilige verehrt. Sie ist die Schutzpatronin der Jungfrauen, Verlobten und der Keuschheit. Der Kirchenvater Ambrosius von Mailand lobte in seinen Schriften ihre außergewöhnliche Schönheit und Glaubensstärke. Im Rahmen des traditionellen Brauchtums segnet der Papst an ihrem Gedenktag zwei Lämmer, deren Wolle für die Herstellung der Pallien verwendet wird.
Historische Unsicherheiten
Obwohl keine gesicherten historischen Berichte über Agnes existieren, lebt ihre Geschichte in der christlichen Tradition weiter. Ihr Name, der "die Reine" bedeutet, spiegelt vermutlich ihre Wesensart wider, und die Berichte über ihr Leben und Martyrium wurden von Generation zu Generation weitergegeben.
Bauernregeln und kulturelle Einflüsse
Agnes' Gedenktag ist auch mit zahlreichen Bauernregeln verbunden, die Wetter und Erntevorhersagen betreffen. Beispielsweise heißt es: „Scheint zu Agnes die Sonne, wird später die Ernte zur Wonne.“ Diese kulturellen Überlieferungen unterstreichen die anhaltende Bedeutung der Heiligen im ländlichen Brauchtum.
Die Kirche St. Agnes in Köln trägt ihren Namen und hat zur Benennung des Kölner Agnesviertels beigetragen, ein weiteres Zeichen für die tief verwurzelte Verehrung der heiligen Agnes in verschiedenen Teilen der Welt.
Gebetswoche für die Einheit der Christen: Ein Zeichen der Hoffnung und Zusammenarbeit
Kirchen in Österreich nutzen das Jubiläum des Konzils von Nicäa als Brücke zur Ökumene.
Die "Gebetswoche für die Einheit der Christen" ist in vollem Gange und wird noch bis zum 25. Jänner in Österreich begangen. Unter dem Leitthema "Glaubst du das?", inspiriert vom Johannes-Evangelium, kommen Gläubige unterschiedlicher Konfessionen zusammen, um für die Einheit der Christenheit zu beten. Diese Woche wird auf der Nordhalbkugel traditionell im Januar begangen, während im Süden die Feierlichkeiten oft auf Pfingsten verlegt werden.
Ein Jubiläum als Brücke zur Einheit
Das Jahr 2025 markiert das 1.700-jährige Jubiläum des ersten ökumenischen Konzils, das 325 n. Chr. in Nicäa stattfand. Dieses historische Ereignis bietet den Kirchen eine einzigartige Gelegenheit, ihren gemeinsamen Glauben zu reflektieren und zu feiern. Das Glaubensbekenntnis von Nicäa bleibt ein gemeinsames Erbe, das die Einheit der Christen stärken soll. Der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) lädt Gläubige ein, sich in den gemeinsamen Glauben zu vertiefen und aus diesem Erbe zu schöpfen.
Zentraler Gottesdienst in Wien
Ein Höhepunkt der Gebetswoche ist der zentrale Gottesdienst des ÖRKÖ am 21. Januar in der griechisch-orthodoxen Dreifaltigkeitskathedrale in Wien. Unter der Leitung von prominenten kirchlichen Vertretern wie Bischof Tiran Petrosyan und Oberkirchenrätin Ingrid Bachler wird der Gottesdienst um 18 Uhr beginnen. Die Kollekte dieses Abends ist einem Hilfsprojekt in Haiti gewidmet.
Ökumenische Gottesdienste im ganzen Land
Österreichweit finden in allen Diözesen ökumenische Gottesdienste statt. In Salzburg wurde die Woche mit einer Segnung der Salzach eröffnet, gefolgt von verschiedenen Gottesdiensten in der Neuapostolischen Kirche und der Rumänisch-orthodoxen Kirche. Ein besonderes Abendgebet mit Taizé-Gesängen wird in der Kirche St. Markus abgehalten.
In Oberösterreich lädt das Forum der christlichen Kirchen zu einem Gottesdienst in der Pfarre Enns-St. Laurenz ein, während in Tirol ein ökumenischer Gottesdienst in der Innsbrucker Pfarrkirche St. Pirmin stattfindet. Auch in Kärnten und Niederösterreich werden zahlreiche ökumenische Veranstaltungen angeboten.
Die Gemeinschaft von Bose: Liturgische Vorbereitung
Die liturgischen Texte zur Gebetswoche wurden von der Gemeinschaft von Bose, einer ökumenischen monastischen Gemeinschaft in Norditalien, vorbereitet. Seit ihrer Gründung im Jahr 1968 verfolgt Bose das Ziel, Christen unterschiedlicher Konfessionen in einer klösterlichen Gemeinschaft zu vereinen. Ihre Gebetszeiten und Arbeiten spiegeln dieses ökumenische Engagement wider und tragen zur spirituellen Tiefe der Gebetswoche bei.
Ausblick
Die Gebetswoche endet mit dem "Sonntag des Wortes Gottes" am 26. Januar. Sie bleibt ein wichtiger Moment des Miteinanders und der Reflexion, der zeigt, wie das gemeinsame Erbe und der Glaube an Christus Brücken zwischen den Konfessionen bauen können. Weitere Informationen zur Ökumene und den Gottesdiensten finden Sie auf den Websites der jeweiligen Kirchen und Diözesen.
Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA
Sebastian von Mailand, ein Name, der seit dem 3. Jahrhundert untrennbar mit Glaubensfestigkeit und Leidensbereitschaft verbunden ist, hat im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche Rollen angenommen. Seine Transformation von einem Märtyrer der frühen Christenverfolgungen zu einer vielschichtigen Figur der Kunst, Kultur und sogar der queeren Bewegung ist bemerkenswert und erzählt eine Geschichte, die weit über die Grenzen der Kirche hinausreicht.
Ein Märtyrer des Glaubens
Sebastian war ein angesehener Hauptmann der Prätorianergarde am Hofe der römischen Kaiser Diokletian und Maximilian. Trotz seines militärischen Erfolgs verbarg er seine christliche Überzeugung nicht, sondern nutzte seine Stellung, um verfolgten Christen beizustehen und selbst Mitglieder der römischen Oberschicht zu bekehren. Als seine wahre Gesinnung ans Licht kam, wurde er vom Kaiser vor Gericht gestellt und zum Tode durch Pfeile verurteilt. Obwohl er diesen qualvollen Angriff überlebte, wagte er es, den Kaiser erneut öffentlich zu konfrontieren. Dieses zweite Martyrium führte schließlich zu seinem endgültigen Tod durch Geißelung.
Sebastians Tod und die Legenden um sein Martyrium begründeten seinen frühen Kult. Bereits im 4. Jahrhundert wurde ihm eine Basilika über seinem Grab errichtet, was seine Bedeutung als dritter Schutzpatron Roms nach Petrus und Paulus unterstreicht.
Der Aufstieg zum Pestheiligen
Im Mittelalter erfuhr der Kult um den heiligen Sebastian eine neue Dimension. Die Pest, oft als göttliche Strafe interpretiert, suchte Europa heim, und die Gläubigen suchten Schutz und Heilung bei Sebastian. Seine Darstellung als Überlebender von Pfeilen, die Seuchen symbolisierten, machte ihn zur Hoffnungsträger gegen die Pest. Berichte von wundersamen Heilungen trugen zur Verbreitung seines Kultes bei, und die Kunst der Renaissance begann, ihn als schönen, unversehrten jungen Mann zu inszenieren – ein Abbild körperlicher Vollkommenheit, das Heilung und Gnade versprach.
Eine neue Ikone entsteht
Im 19. Jahrhundert wandelte sich Sebastians Bild erneut. Die homoerotische Ästhetik seiner Darstellung in der Renaissance fand Anklang bei homosexuellen Künstlern und Intellektuellen. Seine anmutige Darstellung im Leiden bot eine Projektionsfläche für die schmerzvollen Erfahrungen von Diskriminierung und Unterdrückung. Dichter wie August von Platen und später auch Oscar Wilde identifizierten sich mit Sebastian als einem Symbol des leidenschaftlichen, jedoch gesellschaftlich geächteten Begehrens.
Sebastian und die AIDS-Bewegung
In den 1980er Jahren, während der AIDS-Krise, wurde Sebastian zu einer zentralen Figur für Aktivisten und Künstler, die die Stigmatisierung und den Ausschluss von HIV-positiven Menschen anprangerten. Künstler wie David Wojnarowicz nutzten die Ikone Sebastian, um die gesellschaftliche Grausamkeit gegenüber AIDS-Kranken zu kritisieren. Seine Werke, in denen er Sebastian als Protestfigur einsetzte, sind heute bedeutende Zeugnisse einer Zeit, in der Krankheit und Ausgrenzung eine ganze Generation prägten.
Die Kirche und die moderne Rezeption
Die katholische Kirche steht dem modernen Bild Sebastians weitgehend distanziert gegenüber. Die queere Rezeption und die Rolle Sebastians in der Kunst und Aktivismus werden oft nur am Rande erwähnt. Doch gerade in diesen neuen Kontexten lebt die Figur des heiligen Sebastian weiter – als Symbol für den Kampf gegen Ungerechtigkeit, für Heilung und für die Freiheit, seine Identität zu leben.
Ein Fazit
Der heilige Sebastian, einst ein Märtyrer des frühen Christentums, hat sich zu einer vielschichtigen Symbolfigur gewandelt. Er steht nicht nur für Glaubensfestigkeit, sondern auch für die universellen Kämpfe um Akzeptanz, Identität und Gerechtigkeit. Sebastians Geschichte ist eine Erzählung von Transformation, die zeigt, wie sich religiöse Figuren in einem neuen Licht und Kontext neu interpretieren lassen.
Grundlage dieses Beitrages ist das bei Herder 2023 erschienene Buch zum hl. Sebastian von Stephanie Höllinger und Stephan Goertz mit dem Titel "Sebastian. Märtyrer – Pestheiliger – queere Ikone".
Wortlaut der Ansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beim Dankgottesdienst für Kardinal Christoph Schönborn am 18. Jänner im Stephansdom
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Kardinal Christoph Schönborn als Brückenbauer in Religion, Gesellschaft und Politik gewürdigt. In seiner Ansprache am Ende des Dankgottesdienstes am Samstag im Stephansdom mit und für den Wiener Erzbischof bezeichnete das Staatsoberhaupt den bald 80-jährigen Kardinal als "Pontifex austriacus" und hielt fest: "Sie sind ein Mann des Zuhörens, des Dialogs, des Friedens."
Das rund 30-jährige Wirken Schönborns als Wiener Erzbischof sei eine "beeindruckende Zeitspanne", sagte der Bundespräsident und hob das gute Verhältnis zwischen Staat und Kirche hervor. "Wann immer nötig, standen Sie auf Seite der Schwachen, der Ausgegrenzten, der Benachteiligten". Nicht immer zur Freude der politisch Mächtigen", so Van der Bellen. Kathpress dokumentiert die Ansprache des Staatsoberhaupts im vollen Wortlaut:
Sehr geehrte Damen und Herren! Hochwürdigster Herr Kardinal!
Wir alle feiern heute gemeinsam mit Ihnen einen Abschieds- und Dankgottesdienst. Danke, dass Sie uns alle hier Versammelten daran teilhaben lassen.
Es ist, möchte ich anmerken, keine Selbstverständlichkeit, dass Sie, Herr Kardinal, einen Repräsentanten des Staates zu Ihrem Abschiedsgottesdienst eingeladen haben, und ich nun hier im Stephansdom zu Ihnen sprechen darf. Zumal Staat und Kirche in Österreich getrennt sind und ich selbst bekanntlich evangelisch bin.
Das zeugt vom guten Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Österreich, auch wenn es in manchen Belangen natürlich unterschiedliche Auffassungen gibt. Die katholische Kirche unterstützt den Staat bei wichtigen Aufgaben: bei Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern oder mit der Caritas in der Sozialfürsorge. Und diese gute Zusammenarbeit war Ihnen, Herr Kardinal, immer wichtig.
Meine Damen und Herren, wir feiern die Emeritierung von Kardinal Schönborn hier im ehrwürdigen Stephansdom, dem schlagenden Herzen der katholischen Kirche in Österreich.
Und Teil dieser Geschichte sind auch Sie, Herr Kardinal. Seit September 1995, also fast 30 Jahre lang, haben Sie als Erzbischof und etwas später auch als Kardinal die Geschicke der Erzdiözese Wien geleitet. Und 22 Jahre davon, von Juni 1998 bis Juni 2020, waren Sie auch Vorsitzender der Bischofskonferenz.
Gemessen an der zweitausendjährigen Geschichte der Kirche mag das wie eine kurze Zeit erscheinen. Gemessen an der Lebenszeit eines Menschen ist das eine sehr beeindruckende Zeitspanne. Sie werden in Kürze - wohlverdient - den Hirtenstab weiterreichen. Ich glaube, Sie können stolz auf sich sein. Und ich vermute, Sie sind auch dankbar und erleichtert, wenn Sie das Amt weitergeben können.
Ihr Amtsantritt war nämlich kein einfacher. Sie haben schon einiges hinter sich. "Die ersten zehn Jahre musste ich schon ordentlich kämpfen", haben Sie unlängst gesagt. Die "Affäre Groer" lastete damals schwer auf der Kirche.
1996 richteten Sie die "Ombudsstelle der Erzdiözese Wien für Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kirche" ein. Es war europaweit die erste Stelle dieser Art im kirchlichen Bereich. 2010 initiierten Sie die Unabhängige Opferschutzkommission mit Waltraud Klasnic an der Spitze. Diese Kommission war, wie man sich denken kann, nicht unumstritten. Innerkirchlich haben Sie aber damit weltweit Pionierarbeit geleistet! Insgesamt haben Sie durch Ihr Wirken schließlich, poetisch gesagt, das Kirchenschiff aus rauen Gewässern in ruhigere See geführt.
Lieber Herr Kardinal!
In der ORF-Pressestunde Anfang Dezember 2024 haben Sie Ihr Credo artikuliert: Sie sagten (Zitat): "Wir brauchen Brückenbauer. Wir brauchen in einer aufgeregten Zeit, in der die Situation schwieriger wird, Menschen, die echte Handschlagqualität haben und miteinander das Gespräch suchen".
Und zu mir sagten sie neulich: Meistens kann man doch ein Körnchen Wahrheit finden in der Position des anderen. Absolute Gewissheit im Sinne von hier stehe ich, ich kann nicht anders, ist selten. Sie sagten es nicht dazu, aber das war ein Luther-Zitat.
Herr Kardinal, ein Brückenbauer, das sind sie. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, aber ein "Pontifex austriacus" wäre doch ein passender Name!
Sie pflegten und pflegen intensiven Kontakt mit den Ostkirchen. Und mit den anderen großen abrahamitischen Religionen. Das gute menschliche und theologische Verhältnis zum Judentum ist Ihnen immer ein wichtiges Anliegen gewesen. Nicht von ungefähr hielt die Österreichische Bischofskonferenz unter Ihrem Vorsitz 2007 erstmals ihre Vollversammlung in Israel ab.
Und in einem großen Vortrag im Jahre 2001 im Iran, einem muslimischen Land bekanntlich, war Ihre Kernaussage eine Botschaft des Friedens. Christen und Muslime hätten sich jahrhundertelang furchtbar bekämpft. Sie sähen es, so sagten Sie in Teheran, als Ihre Verantwortung an, "etwas dazu beizutragen, dass die Menschen in Frieden und Gerechtigkeit leben". Sie sind ein Mann des Zuhörens, des Dialogs, des Friedens.
Pastorale Höhepunkte Ihrer Zeit als Kardinal waren gewiss die beiden Papstbesuche: 1998 Johannes Paul II. und 2007 Benedikt XVI. An beiden Besuchen nahmen naturgemäß jeweils zehntausende Gläubige teil.
Einen europäischen Akzent setzten Sie 2004 mit dem Mitteleuropäischen Katholikentag in Mariazell. Dieser Tag war wichtig! Er drückte die Freude über die endgültige Überwindung des "Eisernen Vorhangs" und die mit der EU-Osterweiterung geglückte Vereinigung zumindest Westeuropas und Mitteleuropas aus. Diese politische Botschaft wurde durch die Präsenz des damaligen EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi und die Anwesenheit von Staatspräsidenten beteiligter Länder unterstrichen.
Sehr geehrter Herr Kardinal, Sie haben sich immer für Menschen eingesetzt, die am Rande stehen. Entsprechend den Werten des Evangeliums: Mitgefühl, Nächstenliebe, Sorge für die Armen, Zuwendung zu den Notleidenden.
Ich erinnere mich daran, dass Sie selbst Flüchtlinge aufgenommen haben, dass Sie immer wieder Asylsuchende unterstützt haben. "Wir können nicht alles Leid der Welt lösen. (...) Aber das Klopfen der Herbergsuchenden sollten wir nicht überhören", sagten Sie 2020 kurz vor Weihnachten mit Blick auf die tausenden Flüchtlinge auf der Insel Lesbos.
Wann immer nötig, standen Sie auf Seite der Schwachen, der Ausgegrenzten, der Benachteiligten. Nicht immer zur Freude der politisch Mächtigen.
Ich erinnere mich auch, dass Sie 2017 in einem Gottesdienst hier im Dom der AIDS-Opfer gedacht und ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die Stigmatisierung von Menschen mit HIV / Aids gehalten.
Herr Kardinal, wann immer man Ihnen zuhört, ist auch spürbar: Sie sind ein Mann des Glaubens und Sie sind ein großer Kommunikator. Ich beneide Sie darum. Ich habe immer den Eindruck, Sie geben mit Freude Ihren Glauben weiter. Sowohl, wenn Sie persönlich auftreten, als auch in vielen Kommentaren in Tageszeitungen oder via social media.
Davon abgesehen sind sie als Theologe hoch angesehen. Ich habe die Ehrendoktorate nicht nachgezählt, aber es sind so sieben oder acht, glaube ich. Das muss man sich einmal vorstellen... für die Universitätsmenschen unter ihnen... Also: Unser Kardinal ist auch ein Intellektueller, mit dem der geistige Austausch, wie ich erfahren durfte... Ich würde sagen: Er belehrt nicht, aber der Austausch bereitet großes Vergnügen.
Sehr geehrter Herr Kardinal! Zum Abschluss möchte ich Ihnen als Bundespräsident namens der Republik Österreich sehr sehr herzlich danken. Danken für Ihr vielfältiges Engagement, für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Sie immer mit den staatlichen Institutionen gepflegt haben.
Und ich möchte Ihnen auch persönlich danken für unsere Gespräche über Gott und die Welt, wie man so sagt, etwa bei unseren vorweihnachtlichen Mittagessen unter vier Augen.
Sie werden trotz Ruhestand, dessen bin ich mir sicher, weiterhin zuhören, den Dialog suchen, Brücken bauen. Zugleich hoffen wir, haben Sie vielleicht Zeit fürs Jassen. - Können Sie Jassen? (Kardinal nickt) Ja, alle Vorarlberger können Jassen. Zeit für Konzerte im Musikverein und natürlich für Bücher, Literatur. Das wünschen wir alle hier Versammelten, inklusive meiner Frau und mir, Ihnen von ganzem Herzen!
Noch etwas: Die Nachspielzeit seit dem 75er geht zu Ende, haben Sie gesagt. Das stimmt. Die läuft in vier Tagen ab. Es ist, zumindest in Österreich, streng verpönt so lange im Voraus etwas Positives zu sagen. Deswegen beschränke ich mich darauf, Sie zu zitieren, denn das hat mir sehr gefallen: Ti voglio bene. Ti vogliamo tutti bene!
Quelle: Kathpress
Kardinal Christoph Schönborn feierte anlässlich seiner bevorstehenden Emeritierung und seines 80. Geburtstags einen Dankgottesdienst im Wiener Stephansdom. Die Messe stand im Zeichen von Dankbarkeit, Rechenschaft und Hoffnung. Der Kardinal zog dabei eine ehrliche Bilanz seiner fast 30-jährigen Amtszeit und sprach über die Herausforderungen und Chancen der Kirche in Österreich.
Dankbarkeit für das gute Miteinander
In seiner Predigt betonte Kardinal Schönborn die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts: „Ohne das gute, gelebte Miteinander hätte ich nie meinen Dienst tun können.“ Besonders hob er das „Gelingen des gesellschaftlichen Miteinanders von Eingesessenen und Dazugekommenen“ hervor und erinnerte an seine eigene Geschichte als Flüchtlingskind. „Ein Herz für Flüchtlinge zu haben, gehört zur Menschlichkeit. Es kann auch unser Schicksal werden.“
Ehrliche Bilanz und neue Hoffnung
Schönborn sprach offen über die Kirchenaustritte, die 2023 die Zahl von 85.000 erreichten, und sah hierin eine Herausforderung für die Kirche. „Wir nähern uns einem weit verbreiteten religiösen Analphabetismus, der aber auch eine Chance für ein neues Suchen nach Sinn sein kann.“ Gleichzeitig betonte er, dass zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung sich weiterhin ein christliches Land wünschen.
Religiöses Interesse der Jugend
Eine Studie des ORF zeige ein neues, stärkeres religiöses Interesse bei der jungen Generation, so Schönborn. „Ganz überraschend ist es nicht, wenn wir ernst nehmen, dass in jedem Menschenherzen die Suche nach Sinn lebt.“ Der Kardinal sprach von der unerschöpflichen Ressource des Glaubens, die sich in jeder Generation neu erweist.
Ein Glauben, der verbindet
Schönborn betonte, dass der christliche Glauben immer in Gemeinschaft führe und die Kirche eine Vielfalt an Menschen umfasse. „In den 70 Jahren meines bewussten Lebens in der Kirche habe ich das spannende Miteinander großer Unterschiede erlebt.“ Gleichzeitig hob er hervor, dass Jesus nicht gekommen sei, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder, und betonte die Hoffnung, die aus dieser Haltung entspringt.
Feier der Vielfalt
Mehr als 4.000 Personen, darunter Vertreter von Staat und Kirchen, feierten den Gottesdienst mit. Die Liturgie spiegelte die Vielfalt der Kirche wider, mit einem ökumenischen Taufgedächtnis und einer Prozession mit dem Evangeliar. Musikalisch begleitet wurde die Messe von einer Vielzahl von Chören und Organisten.
Abschied mit Dank und Segnung
Zum Abschluss der Messe segnete Kardinal Schönborn ein letztes Mal als Erzbischof seine Diözese, bevor er selbst von der Erzdiözese gesegnet wurde. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte dem Kardinal und sprach dessen Verdienste während der Messe an.
Unterstützung für Hilfsprojekte
Die Kollekte des Gottesdienstes kam zwei Hilfsprojekten zugute: der St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien und einem Altenheim der orthodoxen Kirche in Syrien. Beide Projekte liegen Kardinal Schönborn persönlich am Herzen.
Ein unverbesserlicher Optimist
Kardinal Schönborn schloss seine Predigt mit einer hoffnungsvollen Botschaft: „Vor Gott liegen offen mein Bemühen und meine Fehler. Aber ich brauche Gott nicht zu fürchten. Wir haben Jesus, den Hohepriester, der mitfühlen kann mit unseren Schwächen.“
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Am 17. Jänner wird in ganz Österreich der 25. „Tag des Judentums“ begangen. Dieser Tag soll nicht nur das Christentum in seiner tiefen Verwurzelung im Judentum würdigen, sondern auch dazu anregen, die historische Verbindung zwischen den beiden Religionen bewusst zu reflektieren. Besonders im Kontext von Gottesdiensten und weiteren Veranstaltungen wird auf das gemeinsame Erbe und den Dialog zwischen den Glaubensgemeinschaften hingewiesen.
Ein Gedenktag mit historischer Bedeutung
Der „Tag des Judentums“ wurde erstmals im Jahr 2000 vom Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) eingeführt. Dieser Tag zielt darauf ab, den Christen das Bewusstsein für ihre Wurzeln im Judentum zu stärken und die gemeinsame Weggemeinschaft zu betonen. Besonders im Fokus steht dabei auch die kritische Auseinandersetzung mit dem Unrecht, das jüdischen Menschen und ihrem Glauben in der Geschichte widerfahren ist. Der Gedenktag geht auf die Zweite Europäische Ökumenische Versammlung von 1997 in Graz zurück und wird mittlerweile auch in anderen Ländern wie Italien, Polen und den Niederlanden gefeiert.
Veranstaltungen in ganz Österreich
Der „Tag des Judentums“ wird durch eine Vielzahl an Gottesdiensten und Veranstaltungen im ganzen Land begangen. Ein zentraler Gottesdienst wird am 17. Jänner um 18 Uhr in der katholischen Ruprechtskirche in Wien gefeiert. Dieser wird vom ÖRKÖ in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit ausgerichtet. Die Zeremonie steht unter dem Motto: „Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle; ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit“, ein Zitat aus den Psalmen.
Ökumenische Beteiligung und interreligiöse Kooperation
An diesem besonderen Gottesdienst werden zahlreiche Vertreter der verschiedenen christlichen Konfessionen sowie der syrisch-orthodoxen und griechisch-orthodoxen Kirchen teilnehmen. Zu den Mitwirkenden gehören unter anderem der katholische Kirchenrektor P. Alois Riedlsperger, der ÖRKÖ-Vorsitzende Bischof Tiran Petrosyan und evangelische Superintendent Matthias Geist. Die Predigt wird von der altkatholischen Bischöfin Maria Kubin gehalten. Auch Vertreter der Anglikanischen Kirche sowie der Griechisch-Orthodoxen Kirche werden ihren Beitrag leisten.
Ein symbolischer Auftakt für die Gebetswoche
Der „Tag des Judentums“ fällt bewusst in die Zeitspanne der „Woche der Gebetswoche für die Einheit der Christen“ (18. bis 25. Jänner). Diese Nähe zum Beginn der Gebetswoche betont die Bedeutung des gemeinsamen Dialogs und des Strebens nach Einheit unter den christlichen Kirchen, die alle ihre Wurzeln im Judentum haben. Damit ist der „Tag des Judentums“ auch ein symbolischer Auftakt für die weltweite Gebetswoche, die den interchristlichen Dialog fördert und auf die Notwendigkeit einer geeinten Christenheit hinweist.
Radioübertragung und breitere Reichweite
Der zentrale Gottesdienst in der Ruprechtskirche wird auch von Radio Maria übertragen, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Dadurch wird das Ereignis nicht nur den Teilnehmenden vor Ort zugänglich gemacht, sondern auch all jenen, die über den Rundfunk daran teilhaben möchten.
Der „Tag des Judentums“ stellt somit einen wichtigen Meilenstein in der christlich-jüdischen Beziehung und im interreligiösen Dialog dar. Die Kirchen in Österreich setzen damit ein Zeichen der Erinnerung, der Versöhnung und der Hoffnung für eine gemeinsame Zukunft.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
weitere...
Empfehlungen
Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen
„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen
„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen
Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen
Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen
13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen
66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen
24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen
Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen
Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen
65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen
Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen
Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen
Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen
"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen
HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen
Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen
Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen
Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen
Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen
Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen
Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen
Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen
Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen
Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen
Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen
Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen
Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen
Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen
Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen
Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen
25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen