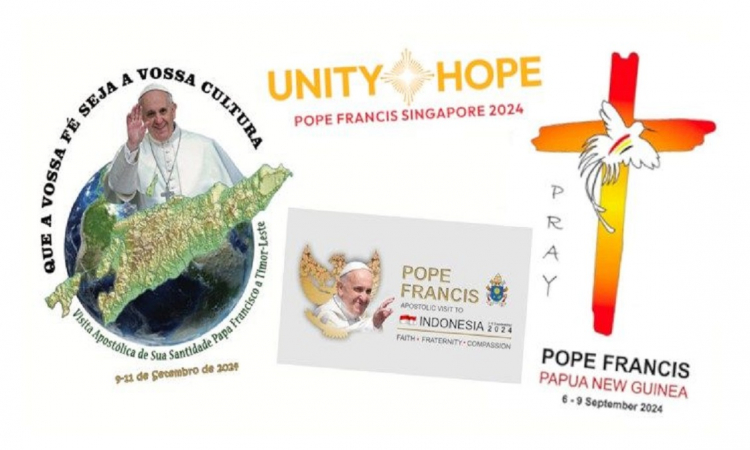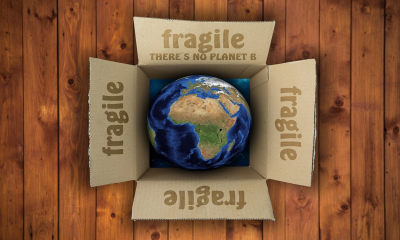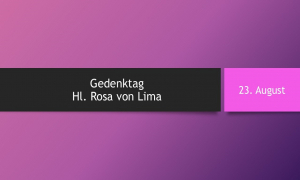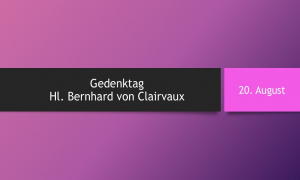Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Papst Franziskus ist auf seiner längsten Auslandsreise in Papua-Neuguinea eingetroffen. Nach seinem Besuch in Indonesien landete der 87-jährige Pontifex am Freitagabend um 19:09 Uhr Ortszeit am internationalen Flughafen der Hauptstadt Port Moresby. Mit militärischen Ehren wurde er von Regierungsvertretern und Ortsbischöfen, darunter Papua-Neuguineas erster Kardinal John Ribat, empfangen. Kinder in traditioneller Kleidung überreichten dem Papst Blumen. Für die Dauer seines viertägigen Aufenthalts wird Franziskus in der vatikanischen Botschaft, der Nuntiatur, übernachten.
Offizielles Programm beginnt mit Treffen und Schulbesuch
Am Samstag startet das offizielle Besuchsprogramm des Papstes mit einem Treffen mit Vertretern der Regierung und Zivilgesellschaft in einem Konferenzzentrum in Port Moresby. Im Anschluss wird Franziskus eine von den Caritas-Schwestern geführte Mädchenschule besuchen. Zudem ist eine Begegnung mit Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und Seelsorgern aus Papua-Neuguinea und den Salomonen geplant.
Am Sonntag zelebriert Papst Franziskus eine Messe in einem Sportstadion, bevor er die Küstenstadt Vanimo nahe der Grenze zu Westneuguinea besucht, die nur per Flugzeug oder Schiff erreichbar ist.
Schwerpunkte der Reise: Interreligiöser Dialog und Klimawandel
Papst Franziskus setzt mit seiner zwölftägigen Reise durch Südostasien und Ozeanien deutliche Akzente auf den interreligiösen Dialog, den Kampf gegen den Klimawandel und die Ermutigung der katholischen Gemeinschaft vor Ort. Nach dem Aufenthalt in Papua-Neuguinea wird er am Montag nach Osttimor weiterreisen. Letzte Station seiner Reise wird Singapur sein. Am 13. September wird der Papst zurück im Vatikan erwartet.
Papua-Neuguinea: Vielfalt der Sprachen und Kulturen
Papua-Neuguinea, das Motto des Papstbesuchs lautet schlicht "Pray" ("Betet"), ist bekannt für seine immense sprachliche und kulturelle Vielfalt. Über 830 ethnische Gruppen mit eigenen Sprachen leben in dem Inselstaat, der zu den am schwersten zugänglichen Ländern der Welt zählt. Das Christentum fasste erst vor etwa 70 Jahren Fuß, heute sind rund 70 % der Bevölkerung Christen, wobei der Großteil Protestanten sind. Etwa ein Viertel der Einwohner ist katholisch.
Soziale und wirtschaftliche Herausforderungen
Papua-Neuguinea steht vor zahlreichen Herausforderungen: Hohe Kriminalität, ethnische Konflikte, schwache Infrastruktur und patriarchale Strukturen prägen das Land. Besonders Frauen leiden unter Gewalt und Verfolgung, wobei Berichte über Vergewaltigungen und Hexenverfolgungen zunehmen. Der Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung ist vielerorts eingeschränkt.
Obwohl das Land über reiche Rohstoffvorkommen verfügt, leben etwa 40 % der 10,3 Millionen Einwohner in extremer Armut. Hinzu kommen die dramatischen Folgen des Klimawandels. Steigende Meeresspiegel, Extremwetter und Umweltzerstörung durch Abholzung und Bergbau bedrohen die Lebensgrundlage vieler Menschen, insbesondere der indigenen Bevölkerung.
Geschichte Papua-Neuguineas
Das Gebiet von Papua-Neuguinea wurde bereits vor rund 50.000 Jahren von Menschen besiedelt. Europäische Seefahrer entdeckten die Insel im 16. Jahrhundert, und ab 1884 wurde der nördliche Teil des Landes als Kaiser-Wilhelms-Land deutsche Kolonie. Seit der Unabhängigkeit von Australien im Jahr 1975 kämpft das Land mit einer instabilen politischen und wirtschaftlichen Lage.
Papst Franziskus hofft, durch seine Besuche die Bevölkerung zu stärken und ein Zeichen der Solidarität zu setzen.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Zur Vorbereitung auf die AIRPOWER24 wurde am 3.9.2024 ein feierlicher Gottesdienst in der traditionsreichen Benediktinerabtei Seckau gefeiert. Inmitten der malerischen Kulisse der Abtei kamen zahlreiche Gläubige und Vertreter des Militärs zusammen, um unter der Leitung von Militärbischof Werner Freistetter den Segen und Schutz Gottes für die bevorstehenden Ereignisse zu erbitten.
Feierliche Atmosphäre und prominente Mitfeiernde
Militärbischof Freistetter zelebrierte den Gottesdienst gemeinsam mit Generalvikar Peter Papst und Bischofsvikar Alexander Wessely. Abt Johannes Fragner hieß die Mitfeiernden herzlich willkommen. Vor dem Gottesdienst stimmte die Militärmusik Steiermark die Anwesenden mit einem Platzkonzert auf den besonderen Moment ein. Die festliche Musik schuf eine würdige Atmosphäre und bereitete die Gläubigen auf die bevorstehende Zeremonie vor.
Bitte um Schutz für die Piloten in der Predigt
In seiner Predigt ging Militärbischof Freistetter auf das Fest des Heiligen Papst Gregor des Großen ein, dessen Gedenktag an diesem Tag gefeiert wurde. Papst Gregor, der im 6. Jahrhundert in einer äußerst schwierigen Zeit das Papstamt innehatte, war bekannt für seine Führungsstärke in Krisenzeiten. Freistetter zog in seiner Ansprache Parallelen zwischen den Herausforderungen, denen sich Gregor gegenübersah, und den heutigen Zeiten. Er hob hervor, dass die Menschheit auch heute vor schwierigen Aufgaben steht, die starke Führung und das Vertrauen in Gott erfordern. Freistetter äußerte die Bitte um Gottes Schutz für die Piloten und die Beteiligten an der AIRPOWER24. Zudem bat er um die Fürsprache des Heiligen Papst Gregor sowie um göttlichen Beistand.
Vorfreude auf die AIRPOWER24
Die AIRPOWER ist die größte Flugshow Europas und findet heuer am 06. und 07. September 2024 unter der Organisation des Österreichischen Bundesheeres in Zusammenarbeit mit Red Bull und dem Land Steiermark in Zeltweg statt. Der Gottesdienst bot den idealen Rahmen, um die Gläubigen und Teilnehmenden auf die bevorstehende AIRPOWER24 einzustimmen. Die internationale Luftfahrtschau wird nicht nur technologische Meisterleistungen präsentieren, sondern auch das hohe Verantwortungsbewusstsein der Beteiligten unterstreichen. Mit dem Segen Gottes und der Hoffnung auf eine erfolgreiche und sichere Veranstaltung blicken alle Beteiligten gespannt auf die kommenden Tage der AIRPOWER24.
Am 28. August 2024, dem Fest des Heiligen Augustinus, feierte Militärsuperior Oliver Hartl, Seelsorger der Militärpfarre 1 beim Militärkommando Niederösterreich, seine Silberne Profess. Als Augustiner-Chorherr des Stiftes Reichersberg blickt Hartl auf 25 Jahre Ordenszugehörigkeit zurück – ein bedeutendes Ereignis, das im Rahmen einer feierlichen Zeremonie begangen wurde.
Zu diesem besonderen Anlass versammelten sich zahlreiche Gäste, darunter Militärdekan P. Gopp, Militäroberkurat P. Stoiber und Pfarradjunkt Vizeleutnant Paier. Die Anwesenheit dieser Vertreter der Militärseelsorge verdeutlicht die enge Verbindung zwischen geistlichem Ordensleben und der Betreuung von Soldatinnen und Soldaten. Einige Militärseelsorger, wie Oliver Hartl, sind selbst Ordensmitglieder und leben ihre Berufung im Dienst für die Truppe.
Die Profess, die Hartl vor 25 Jahren ablegte, ist das zentrale Gelübde eines Ordensmitglieds. Nach einer mehrjährigen Ausbildungszeit verpflichtet sich der Ordensangehörige, sein Leben den Grundsätzen und Regeln der Ordensgemeinschaft zu widmen. Die Silberne Profess markiert den Meilenstein von 25 Jahren in dieser Lebensform – ein Zeichen der Beständigkeit, Treue und Hingabe.
Für Militärsuperior Hartl ist dieses Jubiläum nicht nur ein Rückblick auf ein Vierteljahrhundert im Ordensleben, sondern auch Ausdruck seiner langjährigen Seelsorgetätigkeit im Militär. Sein Wirken bietet Soldatinnen und Soldaten spirituelle Unterstützung und begleitet sie in den Herausforderungen des Dienstes.
Am Sonntag, dem 1. September 2024, fand in der ehrwürdigen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie ein besonderer Sonntagsgottesdienst statt. Militärbischof Werner Freistetter zelebrierte gemeinsam mit Mitbrüdern aus dem Servitenorden eine Messe, die im Zeichen des Friedens stand. Eingeladen waren Mitglieder der Österreichischen Vereinigung der Peacekeeper.
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand das Gedenken an den heiligen Philipp Benizi, den Patron der österreichischen Peacekeeper. Philipp Benizi, ein bedeutender Ordensmann des 13. Jahrhunderts und fünfter Generalsuperior der Serviten, gilt als „zweiter Gründer“ und Erneuerer des Ordens. Sein Leben und Wirken sind untrennbar mit dem Gedanken der Versöhnung und des Friedens verbunden. Benizi, der 1671 heiliggesprochen wurde, verweigerte einst die Papstkrone, um sich stattdessen dem Dienst an den Menschen zu widmen.
In seiner Ansprache hob Militärbischof Freistetter die große Bedeutung des Gebets für den Frieden hervor und wies darauf hin, dass es angesichts der vielen ungelösten Konflikte in der Welt wichtig sei, sich auf die göttliche Kraft zu besinnen. „Heutige Konflikte scheinen ohne göttliche Kraft unlösbar“, betonte er, und appellierte an die Anwesenden, sich unermüdlich für Gerechtigkeit und Versöhnung einzusetzen.
Der Gottesdienst erreichte einen besonders bewegenden Moment, als alle Anwesenden gemeinsam das Benizi-Friedensgebet sprachen. In diesem Gebet, das sich an den heiligen Philipp Benizi richtet, wurde um die Kraft und den Mut gebeten, sich nach seinem Vorbild für Frieden und Versöhnung in der Welt einzusetzen.
Die St. Georgs-Kathedrale, die als Bischofskirche des Militärbischofs dient, bot für diesen Anlass eine beeindruckende Kulisse. Die Verbindung von Militär und Religion, symbolisiert durch die Anwesenheit der Peacekeeper, unterstrich die enge Beziehung zwischen dem Dienst für den Frieden und dem christlichen Glauben.
Bericht von OStR Mag. Serge Claus
Klimaschutz im Fokus: Der Papst mahnt zur Verantwortung
In einer eindringlichen Videobotschaft ruft Papst Franziskus die Weltgemeinschaft zu entschlossenem Handeln gegen den Klimawandel auf. Mit der Aussage "Die Erde hat Fieber" beschreibt er den alarmierenden Zustand unseres Planeten und betont die Dringlichkeit, den Schmerz der Erde und ihrer leidenden Bewohner ernst zu nehmen. Der Vatikan veröffentlichte diese Botschaft am Vorabend des Gebetstags für die Bewahrung der Schöpfung, der am 1. September weltweit begangen wird.
Die Verletzlichsten tragen die größte Last
Besonders hart trifft der Klimawandel die Ärmsten der Welt, erklärt der Papst. Diese Menschen verlieren ihre Heimat durch Naturkatastrophen wie Überflutungen, extreme Hitzewellen und verheerende Dürren. Papst Franziskus unterstreicht, dass die Bewältigung dieser von Menschen verursachten Krisen nicht allein durch ökologische Maßnahmen zu erreichen sei. Vielmehr bedürfe es umfassender sozialer, wirtschaftlicher und politischer Veränderungen.
Ein Appell an die Menschheit: Für Natur und Gerechtigkeit
Franziskus fordert die globale Gemeinschaft dazu auf, sich sowohl dem Schutz der Natur als auch dem Kampf gegen Armut zu widmen. Dies erfordere nicht nur persönliche Verhaltensänderungen, sondern auch einen kollektiven Wandel im Denken und Handeln. "Hören wir auf den Schrei der Erde und der Opfer des Klimawandels", appelliert er eindringlich. Der Papst ruft dazu auf, im Gebet und durch Taten Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten zu übernehmen.
Päpstliche Gebetsvideos: Monatliche Botschaften des Papstes
Diese Videobotschaft ist Teil der monatlichen Gebetsanliegen des Papstes, die von der Vatikan-Stiftung „Gebetsnetzwerk des Papstes“ produziert werden. Jedes Video behandelt ein aktuelles Thema, das Franziskus besonders am Herzen liegt. Die Clips sind auf der Website der Initiative „Das Video des Papstes“ sowie auf YouTube zu finden. Für den Schrei der Erde - Das Video vom Papst 9 – September 2024 (youtube.com)
Für den September richtet sich der Blick auf den „Schrei der Erde“ – ein eindringlicher Weckruf für uns alle, uns aktiv für den Schutz unseres Planeten einzusetzen.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Ein Zeitraum für die Erde: 1. September bis 4. Oktober
Ab dem 1. September lenken die christlichen Kirchen in Österreich wieder die Aufmerksamkeit auf ein zentrales Thema: den Schutz der Schöpfung. Bis zum 4. Oktober, dem Fest des Heiligen Franziskus, wird im Rahmen der „Schöpfungszeit“ landesweit eine Vielzahl von Veranstaltungen und Gottesdiensten stattfinden. Dabei geht es nicht nur um spirituelle Besinnung, sondern auch um konkrete Handlungsimpulse in Sachen Umweltschutz.
Ökumenische Gottesdienste und umweltfreundliche Aktionen
Die Schöpfungszeit bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten. So werden unter anderem ökumenische Schöpfungsgottesdienste und Gebete abgehalten, bei denen die Bewahrung der Schöpfung im Mittelpunkt steht. Eine besonders kreative Aktion ist „Wir RADLn in die Kirche“, bei der Gläubige dazu aufgerufen werden, umweltfreundlich mit dem Fahrrad zum Gottesdienst zu kommen.
Ein Höhepunkt der Schöpfungszeit ist der traditionelle Gottesdienst des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ). Dieser findet in diesem Jahr am 19. September um 19 Uhr in der Christkönigskirche in Wien-Pötzleinsdorf statt. Unter dem Motto „Aus Wüsten Gärten machen“ wird dabei thematisiert, wie gegen die zunehmende Bodenversiegelung vorgegangen werden kann. Eine Predigt des reformierten Landessuperintendenten Thomas Hennefeld wird ebenfalls Teil der Feierlichkeiten sein. Bezugspunkt der Veranstaltung ist eine Bibelstelle aus dem Buch Jesaja: „Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien“ (Jes, 35,2).
Schöpfungstag: Ein globaler Gebetstag für die Umwelt
Der 1. September ist seit 2015 als „Weltgebetstag für die Schöpfung“ im katholischen Kalender verankert. Die Wurzeln dieses besonderen Tages reichen jedoch weiter zurück. Bereits 1989 rief der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Dimitrios I., die gesamte christliche Welt dazu auf, an diesem Tag für die Schöpfung zu beten. Seither haben sich auch die katholische und evangelische Kirche dieser Initiative angeschlossen.
Im Jahr 2007 empfahl die Europäische Ökumenische Versammlung in Sibiu, den Zeitraum zwischen dem 1. September und dem 4. Oktober dem Gebet für den Schutz der Schöpfung und der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils zu widmen – ein Appell, der heute aktueller denn je ist.
Papst Franziskus und Patriarch Bartholomaios: Mahner für die Schöpfungsverantwortung
Besonders Papst Franziskus und Patriarch Bartholomaios I. gelten als prominente Fürsprecher der Schöpfungsverantwortung. In seiner Enzyklika „Laudato si“ von 2015 hebt Franziskus den „grünen Patriarchen“ Bartholomaios als Vorbild hervor. Beide Kirchenführer stehen sinnbildlich für die ökumenische Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel und die Zerstörung der Umwelt.
Mit der Schöpfungszeit setzen die Kirchen in Österreich ein starkes Zeichen: Es ist Zeit, innezuhalten, nachzudenken und vor allem zu handeln – im Sinne einer besseren Zukunft für unsere Erde.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
In einer Welt, die von Kriegen, Klimakrisen, Migration und der zunehmenden Robotisierung geprägt ist, sieht der Wiener Pastoraltheologe Paul Zulehner eine dringende Aufgabe für die Kirchen: Sie sollen als "Hoffnungshebammen in einer angstgetriebenen Welt" auftreten. Doch gleichzeitig erkennt Zulehner eine Mitverantwortung der Kirchen an der Entfremdung von Gott und Religion – eine Entwicklung, die er auf eine "toxische Mischung von Gott und Gewalt" zurückführt.
Die Rolle der Kirche in einer sich wandelnden Welt
In einer Zeit, in der Religion an Relevanz und politischer Kraft verloren hat, fordert der Wiener Pastoraltheologe Paul Zulehner die Kirchen auf, sich politisch zu engagieren. Gerade in Zeiten von Kriegen, Klimanotstand, Migration und Robotisierung sieht er die Kirchen in der Pflicht, ihre Stimme zu erheben und aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken. Im Gespräch mit dem Schweizer Nachrichtenportal "kath.ch" betonte Zulehner die Notwendigkeit, die Herausforderungen unserer Zeit aus der Perspektive des Evangeliums anzugehen.
"Toxische Mischung von Gott und Gewalt"
Zulehner verweist auf eine entscheidende Ursache für die gegenwärtige Krise: den Glaubwürdigkeitsverlust des Christentums. Dieser sei das Ergebnis einer "toxischen Mischung von Gott und Gewalt". Historisch wie auch in der Gegenwart – etwa in Russland oder im sogenannten Kalifat – sei Gott zur Rechtfertigung inhumaner Gewalt missbraucht worden. Dies habe zu einer tiefen Gottvergessenheit und einem weit verbreiteten Misstrauen gegenüber der Religion geführt, was sich in manchen Regionen, wie beispielsweise Ostdeutschland, in "atheisierenden Kulturen" äußere. Dort werde die Leere, die durch den Verlust des Glaubens entstanden sei, zunehmend von rechtsradikalen Ideologien gefüllt.
Kirchen als "Hoffnungshebammen" in einer angstgetriebenen Welt
Trotz dieser düsteren Diagnose sieht Zulehner großes Potenzial in den Kirchen. Sie könnten zu "Sparringspartnerinnen für Sinnsuchende" und "Hoffnungshebammen in einer angstgetriebenen Welt" werden. Die Kirchen bieten seiner Meinung nach die Grundlage für universelle Solidarität, die etwa eine humane Migrationspolitik mit Augenmaß inspirieren könnte. Doch dieses Potenzial bleibe oft ungenutzt, wie Zulehner am Beispiel der kontinentalen Versammlung der europäischen Kirchen in Prag 2023 kritisierte. Während im Europaparlament zentrale Themen wie Migrationspolitik, der Ukraine-Krieg und der "Grüne Deal" diskutiert wurden, habe sich die Kirchenversammlung mit innerkirchlichen Debatten wie der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und dem Diakonat der Frau beschäftigt, ohne zu konkreten Ergebnissen zu kommen.
Aufruf zur politischen Aktivierung von Christen
Um wieder politische Kraft zu entfalten, fordert Zulehner eine stärkere Präsenz überzeugter Christinnen und Christen in politischen Gremien. Diese sollten in Gemeinderäten, Kantonsparlamenten, im Bundeshaus, im Europarat oder bei den Vereinten Nationen das Evangelium in die konkrete Politik einbringen. Zudem seien neue Formen des Austauschs notwendig, um der Religion wieder mehr gesellschaftliche Relevanz zu verleihen. Religions-, Ethik- und Sinnunterricht, eine stärkere mediale Präsenz der Kirchen im Internet und die Diakonie – "die glaubwürdigste Form des Dialogs" – könnten dabei entscheidende Rollen spielen.
Kirchen als "Anwältinnen der Hoffnung"
In einer "Zeit der Gotteskrise" und inmitten einer "weltanschaulichen Blumenwiese" sieht Zulehner die Kirchen in der Rolle der "Anwältinnen der Hoffnung". Zwar könnten die Kirchen heute nicht mehr die Massen erreichen, doch sie hätten die Möglichkeit, Einzelpersonen zu gewinnen und diese in ihre Gemeinschaft zu integrieren. Es gehe darum, diese Menschen für das Evangelium zu begeistern und miteinander zu vernetzen. Auf diese Weise könnten die Kirchen, so Zulehner, zwar nicht in quantitativer Hinsicht wachsen, aber an qualitativer Kraft gewinnen und so ihren Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit leisten.
Quelle: kathpress.at, redigiert durch ÖA
Die erste Heilige Amerikas und ihre unerschütterliche Hingabe
Rosa von Lima, geboren als Isabella Flores de Oliva am 20. April 1586 in Lima, Peru, ist die erste Heilige Amerikas und wird bis heute als Schutzpatronin von Südamerika und der Philippinen verehrt. Ihre außergewöhnliche Hingabe an den Glauben, gepaart mit intensiven Selbstkasteiungen und einer tiefen Liebe zu den Unterdrückten, haben sie zu einer der bemerkenswertesten Figuren der christlichen Mystik gemacht.
Ein Leben der Hingabe und Entbehrung
Von früher Jugend an suchte Rosa den Weg zu Gott durch extreme Bußübungen. Sie fastete regelmäßig drei Tage die Woche, schlief auf einem Bett aus Holzplanken und Scherben und trug eine schmiedeeiserne Dornenkrone, die ihr unsägliche Schmerzen bereitete. Ihre Hingabe ging so weit, dass sie sich die Hände mit ungelöschtem Kalk verbrannte und eine Stachelkette um ihren Körper trug. Die Pein, die sie sich selbst zufügte, sollte ein Ausdruck ihrer Liebe und Nähe zu Christus sein. Ihre Beichtväter schritten schließlich ein, als ihre Selbstgeißelungen ein gefährliches Ausmaß annahmen.
Liebe zu Mensch und Tier
So hart Rosa zu sich selbst war, so liebevoll zeigte sie sich gegenüber anderen – sogar zu den Tieren. Eine Legende erzählt von Moskitos, die in der Nähe ihrer Hütte in Scharen lebten. Während sie andere Menschen quälten, verschonten sie Rosa. Diese erklärte, sie habe sich mit den Moskitos angefreundet, und gemeinsam würden sie zum Lobe Gottes singen. Einem Besucher führte sie dieses Wunder vor, als die Moskitos im Einklang mit ihrem Gesang harmonische Klänge erzeugten.
Einsatz für die Unterdrückten und Kritik am Klerus
Rosa von Lima trat dem Dritten Orden der Dominikaner bei und lebte fortan in einer einfachen Holzbaracke im Garten ihrer Eltern. Trotz ihrer strengen Selbstdisziplin fand sie Zeit, den unterdrückten Indios zu helfen und den oft ausschweifenden Lebensstil des Klerus zu kritisieren. Ihre Hilfe für die Armen und ihre Ermahnungen an die Priester machten sie nicht nur zur spirituellen Führerin, sondern auch zu einer sozialen Aktivistin ihrer Zeit.
Mystik und Taten
1614 gründete Rosa das Kloster der Katharina von Siena, benannt nach ihrer großen spirituellen Vorbildin. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie als Hausangestellte, wo sie weiterhin ihrer Berufung nachging, Menschen in Not zu unterstützen. Kurz nach ihrem 31. Geburtstag sagte sie ihren Tod voraus, der tatsächlich vier Monate später eintrat. Rosa ertrug ihre letzte Krankheit mit der gleichen Geduld und Hingabe, die ihr ganzes Leben geprägt hatten.
Vermächtnis und Verehrung
Bereits zu Lebzeiten galt Rosa von Lima als Heilige, und ihre Verehrung setzte unmittelbar nach ihrem Tod ein. Im Jahr 1671 wurde sie von Papst Clemens X. offiziell heiliggesprochen und somit zur ersten Heiligen Amerikas ernannt. Ihr Bild ziert den 200-Sol-Schein der peruanischen Nationalbank, und in Südamerika wird sie heute als Schutzpatronin verehrt. Auch in Deutschland lebt ihr Erbe weiter: Am 30. August 1961, ihrem damaligen Gedenktag, beschlossen die deutschen Bischöfe, Spenden für die Kirche in Lateinamerika zu sammeln, woraus das Hilfswerk Adveniat entstand.
Rosa von Lima bleibt ein leuchtendes Beispiel für Hingabe, Selbstaufopferung und unerschütterliche Liebe – eine Heilige, deren Leben und Werk auch nach über 400 Jahren noch nachhallt.
Eine Jugend voller Möglichkeiten
Bernhard von Clairvaux, geboren um 1090 in Fontaine-lès-Dijon, einem Vorort von Dijon in Frankreich, wuchs in einer adligen und tief religiösen Familie auf. Schon in seiner Jugend zeichnete sich ab, dass Bernhards Weg kein gewöhnlicher sein würde. Obwohl er, dank der Fürsorge seiner Eltern, eine klassische Bildung genoss und durchaus eine Karriere als Ritter hätte einschlagen können, zog es ihn in eine ganz andere Richtung. Schon früh verspürte er den tiefen Wunsch, sich ins Kloster zurückzuziehen und sein Leben in stiller Kontemplation und Arbeit zu verbringen.
Der Weg ins Kloster und die Reformbewegung
Der Tod seiner Mutter um 1105 beeinflusste Bernhard stark und brachte ihn dem geistlichen Leben näher. Im Jahr 1113 trat er, zusammen mit 30 weiteren adligen jungen Männern, darunter vier seiner Brüder, in das Reformkloster Cîteaux ein. Das Kloster, das 1098 von Robert von Molesme gegründet worden war, kämpfte zu dieser Zeit um sein Überleben, da die strengen Regeln des neu gegründeten Zisterzienserordens viele Menschen abschreckten. Doch Bernhard brachte mit seiner Gruppe neues Leben in die Gemeinschaft, was zur Gründung weiterer Klöster, wie La Ferté und Pontigny, führte.
Aufstieg zum Abt von Clairvaux
Im Jahr 1115 sandte Abt Stephan Bernhard mit zwölf Mönchen aus, um das Kloster Clairvaux zu gründen. Unter Bernhards Führung entwickelte sich Clairvaux zur bedeutendsten Zisterzienserabtei. Bernhard zog Novizen in solchem Maße an, dass fast jedes Jahr neue Klöster gegründet wurden. Bis zu seinem Tod im Jahr 1153 unterstanden ihm insgesamt 164 Abteien, und es waren bereits 343 neue Gründungen gezählt.
Bernhard als Reformator und Diplomat
Bernhard war nicht nur ein kluger Klostergründer, sondern auch ein Mann von enormem Einfluss. Im Jahr 1118 wurde er zum Leiter des Zisterzienserordens ernannt, wo er die Ordensregeln erneuerte und die Bedeutung der körperlichen Arbeit betonte. Seine Reformen stellten ihn in Gegensatz zu den Benediktinern, die ihre Niederlassungen auf Höhen errichteten, während Bernhard sumpfige Täler bevorzugte.
Doch Bernhards Einfluss reichte weit über die Klostermauern hinaus. Seine Treue zum Papsttum und seine Fähigkeit, scharfe Kritik an den Päpsten zu üben, brachten ihm sowohl Bewunderung als auch Feinde ein. Besonders im Schisma von 1130, als Papst Innozenz II. gegen Gegenpapst Anaklet II. antrat, spielte Bernhard eine entscheidende Rolle. Er reiste durch Europa, um Unterstützung für Innozenz zu organisieren, und trug maßgeblich zu dessen Erfolg bei.
Einfluss auf die Kreuzzüge und die Kirche
Bernhards Einfluss erstreckte sich auch auf die Kreuzzüge. Im Jahr 1146 rief er in Vézelay zum Zweiten Kreuzzug auf. Seine Predigt löste eine Welle der Begeisterung in ganz Frankreich aus, und selbst König Ludwig VII. entschloss sich, sich dem Kreuzzug anzuschließen. Doch der Misserfolg des Kreuzzugs traf Bernhard schwer, und seine erneute Initiative im Jahr 1150 blieb erfolglos.
Trotz seiner vielen Erfolge war Bernhard nicht ohne Widersacher. Er bekämpfte die Katharer und die Reformationsideen von Petrus Waldus ebenso wie die rationalistische Philosophie von Petrus Abaelard, deren Lehrsätze er 1140 durch das Konzil von Sens verurteilen ließ.
Das Erbe des „Doctor mellifluus“
Bernhard von Clairvaux hinterließ ein reiches theologisches und spirituelles Erbe. Seine Schriften, darunter „De gradibus humilitatis et superbiae“ und „De diligendo Deo“, sind bis heute aktuell und zeugen von seiner tiefen Mystik und Spiritualität. Besonders bekannt wurde er als Verfasser von Hymnen, die teilweise noch heute gesungen werden.
Seine lebenslange Marienverehrung spiegelt sich in zahlreichen Legenden und Darstellungen wider, in denen Maria ihm erscheint. Bernhards Hingabe und seine strikte Askese machten ihn zu einer herausragenden Gestalt der Kirche. Bei seinem Tod im Jahr 1153 gehörten 344 Klöster in ganz Europa zum Zisterzienserorden.
Bernhard wurde 1174 heiliggesprochen und 1830 von Papst Pius VIII. zum Kirchenlehrer ernannt. Sein Erbe lebt bis heute in der katholischen Kirche fort, und seine Schriften und Gedanken beeinflussten Generationen von Theologen und Gläubigen.
Das Fest Maria Königin wird jedes Jahr im August begangen. Es ist ein Tag, an dem Maria, die Mutter Gottes, als Königin der Engel und Heiligen geehrt wird. Dieser Gedenktag hat im Christentum eine tiefe Bedeutung und wird weltweit in vielen Gemeinden feierlich begangen.
Datum und Bedeutung: Wann wird Maria Königin gefeiert?
Die Einführung des Festes Maria Königin geht auf Papst Pius XII. zurück, der am 1. November 1954 in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom die Feierlichkeiten ins Leben rief. Ursprünglich war der Gedenktag auf den 31. Mai festgelegt, den letzten Tag des Marienmonats. Im Zuge einer Kalenderreform durch Papst Paul VI. im Jahr 1969 wurde das Datum jedoch auf den 22. August verschoben. Dieser Tag war zuvor der Gedenktag der Mariä Aufnahme in den Himmel, was die enge Verbindung zwischen Marias Himmelfahrt und ihrer Würde als Königin unterstreicht.
Maria Königin: Die Bedeutung des Gedenktags
Maria wird in der christlichen Tradition unter vielen ehrwürdigen Titeln verehrt: Sie ist die Königin der Engel und Heiligen, die Gottesmutter und Erlösermutter. Als Mutter Jesu spielt Maria eine zentrale Rolle im Sieg über Sünde und Tod. In der Kunstgeschichte finden sich bereits seit dem späten 4. Jahrhundert Darstellungen, die Maria in königlicher Würde zeigen. Besonders im Mittelalter verstärkte sich diese Verehrung, und in zahlreichen Skulpturen und Gemälden wird Maria als Königin dargestellt, oft mit einem prächtigen Heiligenschein oder einer Krone, die ihr von Christus oder Engeln verliehen wird.
Die Verehrung Marias als Königin nahm im zweiten Jahrtausend im Westen weiter zu. In Marienbildern erscheint Maria vorwiegend als Himmelskönigin, was ihre zentrale Stellung in der christlichen Frömmigkeit unterstreicht. Maria ist eine der am häufigsten dargestellten und verehrten Figuren im Christentum, und ihre Bedeutung spiegelt sich in der Vielzahl an Festen und Gebeten wider, die ihr gewidmet sind.
Besonderheiten des Festes Maria Königin
Das Fest Maria Königin ist reich an liturgischen Traditionen. In vielen Gebeten und Liedern wird die himmlische Königin Maria besungen. Das Tagesgebet zu Maria Königin lautet: "Gott, du hast die Mutter deines Sohnes auch uns zur Mutter gegeben. Wir ehren sie als unsere Königin und vertrauen auf ihre Fürsprache. Lass uns im himmlischen Reich an der Herrlichkeit deiner Kinder teilhaben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn."
Das Fest Maria Königin: Ein Tag, an dem die Gläubigen eingeladen sind, Maria als Königin zu ehren und ihre Fürsprache zu erbitten. Diese Feier ist ein wichtiger Bestandteil des kirchlichen Lebens und bietet den Gläubigen eine Gelegenheit, ihre Marienverehrung in einem feierlichen Rahmen zu pflegen und zu bekräftigen.
weitere...
Empfehlungen
Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen
„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen
„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen
Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen
Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen
13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen
66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen
24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen
Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen
Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen
65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen
Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen
Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen
Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen
"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen
HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen
Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen
Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen
Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen
Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen
Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen
Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen
Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen
Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen
Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen
Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen
Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen
Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen
Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen
Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen
Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen
25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen