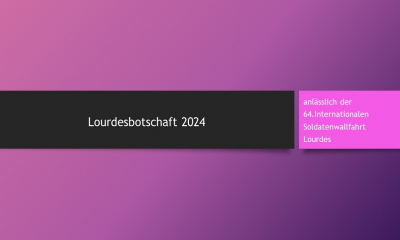Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Diözese
Aktuelles aus der Diözese
„Der liturgische Bücherschatz“ war das Thema der Jahrestagung der kirchlichen Bibliotheken Österreichs von 3.-5. Juni 2024 im Konvent der Benediktinerinnen der Anbetung in Wien-Ottakring. Dort steht auch eine im Aufbau befindliche Handbibliothek für die Schwestern sowie Mitarbeiter und Gäste zur Verfügung.
Was genau sind eigentlich „liturgische Bücher“ und was nicht? Wie sollen kirchliche Bibliotheken mit dieser wichtigen Gattung von Büchern im Detail umgehen, und was soll mit den Dopplungen geschehen, die insbesondere nach dem Erscheinen neuer Ausgaben in großer Zahl vorhanden sind? Hier gibt es mehrere Optionen (alle Exemplare aufheben, vergraben, verbrennen, schreddern, zum Altpapier geben, zu Kunstobjekten verarbeiten...), das Thema ist aber natürlich schwierig, eine klare Empfehlung steht noch aus. Weitere Themen waren die Möglichkeiten einer bibliothekarischen Nutzung von Kirchenräumen - auch ohne Profanierung -, sowie die Finanzbeschaffung für Bestandsprojekte.
Veranstaltet wurde die Tagung, an der auch ein Mitarbeiter der Militärbischöflichen Bibliothek teilnahm, von der Arbeitsgemeinschaft der Ordensbibliotheken Österreichs, der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken (AKThB) und der Kommission für Theologische Spezialbibliotheken der Vereinigung Österreichischer Bibliothekare (VÖB).
Wiener Neustadt – Am 30. Mai 2024, unter strahlendem Himmel, versammelten sich die Gläubigen der Neukloster-, Dom-, Militärpfarre und der Kapuzinerkirche, um das Hochfest des Leibes und Blutes Christi zu feiern. Hauptzelebrant des Festgottesdienst, der im idyllischen Neuklostergarten stattfand, war Militärbischof Werner Freistetter. In einer beeindruckenden Prozession zog man vom Neukloster über den Hauptplatz bis zum Neustädter Dom.
In seiner Predigt sprach Dompropst Franz Xaver Brandmayr über den Namen Gottes, über „Jahwe“, und erklärte, dass dieser mehr bedeute als nur „Ich bin, der ich bin“ – es stehe für Gottes Wirksamkeit und Nähe. „Wir erfahren Gottes Wirksamkeit, wenn wir unser Herz öffnen. Die Beziehung zu ihm vertieft sich, die Welt tut sich auf,“ so der Dompropst. „Gott schließt seinen Bund in seinem Blut und seinem Leben. Gott selbst gibt sich in unsere Hand.“
Der Prozession folgte eine Segnung der Stadt auf dem Wiener Neustädter Hauptplatz. P. Michael Weiss OCist, der Pfarrer des Neuklosters, verglich die Prozession mit einem „mobilen Schaufenster“, das Jesus Christus in der Monstranz durch die Straßen trägt und ihn den Menschen näherbringt. „Es geht darum, Christus für die Menschen interessant zu machen und das Bewusstsein zu stärken, was wir jeden Sonntag feiern: ‚Das bin ich für Dich, tue das zu meinem Gedächtnis, und ich bin bei euch jeden Tag.‘ So gehe ich alle Gassen deines Lebens mit Dir,“ sagte der Pfarrer.
Die Segnung galt auch für diejenigen, die nicht an der Prozession teilnehmen konnten, und für alle, die Christus noch nicht kennen. Nach einem Ehrensalut des privilegierten uniformierten Bürgerkorps setzte die Prozession ihren Weg zum Mariendom fort, wo das große „Te Deum“ – „Großer Gott, wir loben Dich“ – die feierliche Prozession abschloss.
Interessante Fakten über Fronleichnam:
Ursprung: Das Fest geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Die Augustinernonne Juliana von Lüttich hatte eine Vision, die schließlich zur Einführung des Festes führte. 1246 führte Bischof Robert von Lüttich das Fest in seinem Bistum ein, und Papst Urban IV. erhob es 1264 zum Fest der gesamten Kirche.
Blutwunder von Bolsena: Ein weiteres Ereignis, das zur Einführung von Fronleichnam beitrug, war das Blutwunder von Bolsena im Jahr 1263. Ein Priester entdeckte während der Messe Blutstropfen auf den geweihten Hostien, was ihn von der realen Präsenz Christi in der Eucharistie überzeugte.
Brauchtum: Fronleichnam wird mit prächtigen Prozessionen gefeiert, bei denen Kinder Blumen streuen und die Straßen mit Birkenbäumchen und Blumen geschmückt werden. In einigen Regionen Südösterreichs gibt es Blumenteppiche und Blumenbilder sowie Seeprozessionen.
Fronleichnam verbindet tiefe religiöse Bedeutung mit farbenfrohem Brauchtum und Gemeinschaftsgefühl, was es zu einem der eindrucksvollsten Feste im Kirchenjahr macht.
Text: Mag. Serge Claus, redigiert durch ÖA
Eine große Wallfahrt geht zu Ende. Tausende Soldatinnen und Soldaten aus 42 Nationen kamen zur 64. Internationalen Soldatenwallfahrt in den südfranzösischen Wallfahrtsort Lourdes. Diese besondere Wallfahrt bot eine einzigartige Gelegenheit, Freundschaften zu schließen, gemeinsam zu beten und für Frieden und Gesundheit zu bitten.
Das heurige Motto von Lourdes: „Kommt in Gemeinschaft hierher.“
Das diesjährige Motto der Internationalen Soldatenwallfahrt, „Kommt in Gemeinschaft hierher“, spiegelte den Geist der Veranstaltung wider. Wie Militärbischof Werner Freistetter aus Österreich betonte, bedeutet Menschsein immer in Bewegung zu sein, sowohl körperlich als auch geistig. „Wir Menschen können ohne Gemeinschaft nicht leben, weder körperlich noch seelisch“, erklärte er. So erinnerte diese Wallfahrt die Teilnehmer daran, dass unser ganzes Leben, so wenig wir es selbst verstehen mögen und so ausweglos es manchmal erscheinen mag, eine Prozession ist – ein Gehen mit anderen Menschen von Gott her auf Gott hin.
Kameradschaft über Grenzen hinweg.
Die Soldatenwallfahrt in Lourdes war geprägt von einer bemerkenswerten Kameradschaft, die über nationale und kulturelle Grenzen hinweg reichte. Soldatinnen und Soldaten, die sich zuvor nie begegnet waren, fanden in Lourdes zusammen und schlossen neue Freundschaften. Die gemeinsame Erfahrung des Militärdienstes und der damit verbundenen Herausforderungen schuf eine tiefe, vielleicht auch eine bleibende Verbundenheit.
Gemeinsames Gebet und Feiern.
Das gemeinsame Gebet stand im Mittelpunkt der Wallfahrt. Täglich versammelte man sich zu Messen und Andachten, um die Anliegen vor Gott zu bringen. Eine besonders bewegende und beeindruckende Erfahrung: die Heiligen Messen an der Grotte von Massabielle, wo die Heilige Bernadette Soubirous die Jungfrau Maria gesehen haben soll.
Begegnungen und Aufeinanderzugehen
Ein zentraler Aspekt der Wallfahrt war das Aufeinanderzugehen und der Austausch mit Soldatinnen und Soldaten aus anderen Armeen. Diese Begegnungen ermöglichten es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, neue Perspektiven zu gewinnen, Vorurteile abzubauen und neue Freundschaften zu schließen. Der Dialog und die gemeinsame Zeit halfen, ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln und den Weg für zukünftige friedliche Kooperationen zu ebnen.
Gebet für Frieden und Gesundheit.
In einer Welt, die oft von Konflikten und Unsicherheit geprägt ist, war das Gebet für Frieden ein zentrales Anliegen in Lourdes. Viele brachten ihre persönlichen Bitten um Heilung und Gesundheit mit und suchten Trost und Hoffnung in den heiligen Stätten von Lourdes. Besonders eindrucksvoll war das Entzünden von Kerzen durch die Heeresangehörigen - begleitet von einer ganz eigenen Körperhaltung und einem erwartungs- und hoffnungsvollen Blick. Diese "symbolischen Akte des Glaubens und der Hoffnung" standen für die stillen Bitten und die sehnsuchtsvoll vorgetragenen Wünsche.
Die einzigartigen Lichterprozessionen.
Einer der Höhepunkte der Wallfahrt waren die stimmungsvollen Lichterprozessionen, die jeden Abend stattfanden. Tausende zogen mit Kerzen in den Händen durch die Straßen von Lourdes und schufen ein beeindruckendes Bild der Einheit und des Friedens. Die Lichter symbolisierten die Hoffnung und den Glauben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und boten einen bewegenden Anblick, der noch lange den Mitgehenden in Erinnerung bleiben wird.
Kreuzweg: Gehen und Beten.
Eine weitere bleibende Erfahrung war das Gehen und Beten des Kreuzweges in Lourdes. Die Soldaten folgten den Stationen des Kreuzweges und meditierten - angeleitet durch Militärgeistliche - über das Leiden und die Auferstehung Christi.
Ein unvergessliches Erlebnis.
Die 64. Internationale Soldatenwallfahrt in Lourdes war eine tiefbewegende und unvergessliche Erfahrung für alle Teilnehmenden. Sie bot eine einzigartige Gelegenheit, den Glauben zu vertiefen, neue Freundschaften zu schließen und gemeinsam für eine bessere Welt zu beten. In einer Zeit der Unsicherheit und des Wandels wurde der Blick auf Gemeinschaft, Frieden und Zuversicht gerichtet. Und irgendwie verspürte man, dass der gemeinsame Glaube Berge versetzen kann.
Papst Franziskus hat anlässlich der 64. Internationalen Soldatenwallfahrt im französischen Wallfahrtsort Lourdes eine eindringliche Botschaft an die Teilnehmer gesandt. In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung des Glaubens und der Friedensmission der Soldaten in einer turbulenten Welt. Der Papst rief dazu auf, das Evangelium auch im militärischen Kontext zu leben und die Waffen im Dienst des Friedens und der Geschwisterlichkeit einzusetzen.
Österreichische Soldatinnen und Soldaten in Lourdes
Unter den tausenden Soldaten aus rund 40 Nationen, die sich noch bis Sonntag in Lourdes versammelt haben, um gemeinsam für den Frieden zu beten, befindet sich auch eine bedeutende Delegation aus Österreich. 400 österreichische Soldatinnen, Soldaten und Armeeangehörige, angeführt von Militärbischof Werner Freistetter, sind dieses Jahr nach Lourdes gereist, um an der Wallfahrt teilzunehmen und ihre Solidarität zu zeigen.
Aufruf zur geistigen Pilgerreise
Papst Franziskus nahm Bezug auf die junge Bernadette Soubirous, die im Jahr 1858 die Jungfrau Maria gesehen haben soll und von ihr aufgefordert wurde, eine Kapelle zu bauen. Analog dazu lud der Papst die Soldaten ein, sich geistig „auf den Weg zu machen“ – zu Gott und zu ihren Mitmenschen, um eine geeintere und geschwisterlichere Welt aufzubauen. Dies sei ein essentielles Engagement, da Soldaten eine unersetzliche Rolle für das Gemeinwohl und den Weltfrieden spielten, betonte Franziskus in seiner von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichneten Botschaft.
Nähe zu verletzten Kameraden
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Wallfahrt ist laut Papst Franziskus die Glaubenserfahrung und die gegenseitige Unterstützung unter den Soldaten. Die Wallfahrt biete eine wertvolle Gelegenheit, den kranken und verwundeten Kameraden nahe zu sein und sich um sie zu kümmern. „Die Schönheit des gemeinsamen Gehens und der Begegnung mit anderen wird hier deutlich“, so der Papst. Diese Erfahrung helfe, die Barmherzigkeit Gottes in die militärische Welt zu bringen.
Soldaten als Hoffnungsträger
In einer abschließenden Mahnung betonte Franziskus die Dringlichkeit der Mission der Soldaten in der heutigen Zeit. „Die Welt braucht euch, besonders in diesem dunklen Augenblick unserer Geschichte“, sagte der Papst. „Wir brauchen Männer und Frauen des Glaubens, die fähig sind, die Waffen in den Dienst des Friedens und der Geschwisterlichkeit zu stellen.“
Die 64. Internationale Soldatenwallfahrt in Lourdes hat somit nicht nur eine spirituelle, sondern auch eine starke friedensstiftende Dimension. Die Teilnahme von Soldaten aus der ganzen Welt, darunter auch eine bedeutende Gruppe aus Österreich, unterstreicht die universelle Sehnsucht nach Frieden und Gemeinschaft in turbulenten Zeiten.
„Kommt in Gemeinschaft hierher“ – so lautet das diesjährige Motto der Internationalen Soldatenwallfahrt nach Lourdes. Es beschreibt in wenigen Worten sehr gut, was bei dieser Wallfahrt passiert.
- Wir kommen. Menschsein bedeutet immer in Bewegung sein. So sehr wir auch manchmal wünschen mögen, dass sich nichts verändert – die Zeit geht weiter und wir verändern uns mit ihr. Auch als Glaubende sind wir immer in Bewegung, die aber nie beliebig ist, irgendwohin ins Leere geht. Glaube ist nie nur ein Gehen, sondern immer auch ein Kommen: Er kommt „von woher“, braucht einen Anstoß, ruht auf einem uns vielleicht gar nicht mehr bewussten Grund: Wir brauchen dazu Menschen, denen wir vertrauen können, Worte, die uns berühren und bewegen, Erfahrungen von Liebe und Geborgenheit. Und Glaube ist immer auch Glaube auf etwas hin, das wir kennen und doch nicht kennen, auf den lebendigen Gott, der unser Leben und unseren Glauben trägt und durchdringt und zugleich für uns undurchdringliches Geheimnis bleibt.
- Wir kommen in Gemeinschaft. Wir Menschen können ohne Gemeinschaft nicht leben, weder körperlich noch seelisch. Das bedeutet nicht, dass wir nicht allein sein können und dürfen, dass wir immer Menschen um uns haben müssen. Aber unser ganzes Leben, unser Denken, Fühlen und Handeln ist auf anderes Leben hingeordnet. Wenn wir fühlen, fühlen wir immer irgendwie mit anderen mit, auch wenn wir das gar nicht wissen oder gar nicht wollen. Wenn wir denken, denken wir in einer gemeinsamen Sprache, in gemeinsamen Bildern, selbst wenn wir träumen… Nach den Worten der Bibel hat Gott die Welt durch sein Wort geschaffen und Menschen als sein Abbild, damit sie ihn in Freiheit erkennen, ansprechen und lieben können. Das Johannesevangelium erzählt von Gottes Menschwerdung als dem Kommen des „Logos“, des „Worts“, in die gemeinsame Welt.
Wenn das diesjährige Motto im französischen Original von „Prozession“ spricht, in der wir nach Lourdes kommen sollen, so meint es nicht in erster Linie eine konkrete liturgische Feier, ein bewusstes feierliches Miteinandergehen, das wir in Lourdes jeden Tag erleben, sondern es will uns daran erinnern, dass unser ganzes Leben, so wenig wir es selbst verstehen mögen und so ausweglos es uns manchmal erscheint, in Wirklichkeit eine Prozession ist, ein Gehen mit anderen Menschen von Gott her auf Gott hin, dem letzten, verborgenen Ziel unseres Lebens.
- Wir kommen in Gemeinschaft hierher. Wenn wir nach Lourdes kommen, in diese kleine französische Stadt am Fuß der Pyrenäen, dann tun wir das nicht, weil Gott anderswo weniger gegenwärtig wäre als hier im heiligen Bezirk. Wallfahrten führen immer zu konkreten Orten, weil es immer konkrete Menschen an konkreten Orten sind, die geheimnisvolle Begegnungen erlebt oder überwältigende Erfahrungen gemacht haben – meist in einer für sie sehr schwierigen Zeit. Und manchmal wird ihre Geschichte auch für andere Menschen wichtig: Sie tröstet sie und hilft ihnen – wie die Begegnungen der heiligen Bernadette, eines Mädchens aus einfachen und tristen Verhältnissen, der eine geheimnisvolle junge Frau erschienen ist. Die Schönheit dieser kurzen Begegnungen hat ihr gesamtes weiteres Leben verändert, und im Wasser der Quelle, die aus dieser Begegnung hervorgegangen ist, suchen noch immer viele Menschen Trost und Heilung von ihren Krankheiten.
Machen Sie sich gemeinsam auf und kommen Sie mit uns nach Lourdes! Lassen Sie sich auf die zahlreichen Begegnungen ein, die Sie hier erleben werden! Nutzen Sie die Feiern und die Zeiten des Gebets und der Stille, um über den Weg nachzudenken, den Sie bisher gegangen sind und den Sie in Zukunft gehen wollen! Vielleicht hilft Ihnen das Beispiel dieses kleinen, bescheidenen Mädchens aus Lourdes, manche Dinge anders einzuordnen und Wege des Glücks und der Liebe zu Gott und den anderen Menschen zu finden.
Ihr Militärbischof
+ Werner Freistetter
Am Mittwoch, dem 22.Mai, meldete sich die österreichische Delegation unter der Leitung von Militärpfarrer Oliver Hartl als „Chef de délégation“ bei der Direktion des Pèlerinage Militaire International (PMI) in Lourdes an.
Der Vizepräsident der PMI, Jean-Marc Fournier, hieß die österreichische Delegation herzlich willkommen.
Im Zuge der Anmeldung wurden die Pilgerabzeichen und Zutrittsberechtigungen ausgegeben, organisatorische Details besprochen und Beiträge eingezahlt.
Die österreichische Delegationsleitung nutzte zudem die Gelegenheit zu einem kurzen kameradschaftlichen Austausch mit der französischen PMI-Direktion.
Es gibt viele Arten, nach Lourdes zu Reisen: Per Zug, Reisebus, Flugzeug oder zu Fuß. Vizeleutnant Florian Atzlesberger von der Lehrkompanie des Panzerstabsbataillons 4 in Freistadt entschied sich für das Rad und hat am 22.05.2024 nach einer beeindruckenden Radfahrt von über 2.000 Kilometern sein Ziel in Lourdes erreicht. Seine Reise begann am 13. Mai 2024 in seinem Heimatort St. Johann am Wimberg im oberösterreichischen Mühlviertel.
Auf seiner Fahrt legte Atzlesberger 2.231 Kilometer zurück und durchquerte Österreich, Liechtenstein, die Schweiz und Frankreich, wobei er insgesamt 21.500 Höhenmeter überwand.
In Lourdes wurde er herzlich von der österreichischen Pilgerleitung empfangen, die bereits vor Ort ist. Militärpfarrer Oliver Hartl, Oberst Michael Jedlicka und weitere Mitglieder der Pilgerleitung gratulierten ihm zu dieser außergewöhnlichen Leistung und hießen ihn zur 64. Internationalen Soldatenwallfahrt willkommen.
Der Mai, traditionell als Marienmonat bekannt, ist eine besondere Zeit der Verehrung der Muttergottes in der katholischen Kirche. In diesem Monat finden zahlreiche Andachten, Prozessionen und Gebete zu Ehren der Jungfrau Maria statt. Gläubige schmücken Marienaltäre mit Blumen, singen Marienlieder und rezitieren den Rosenkranz. Die feierlichen Aktivitäten sind Ausdruck der tiefen Verehrung und Liebe, die die Gläubigen der Muttergottes entgegenbringen. Dieser Monat dient dazu, Marias Rolle als Fürsprecherin und Beschützerin der Gläubigen zu betonen und ihren Beistand in persönlichen und gemeinschaftlichen Anliegen zu erbitten.
Pilgerreisen zu Marienwallfahrtsorten im Mai
Im Marienmonat Mai verstärkt sich auch der Zustrom zu Marienwallfahrtsorten, die von den Gläubigen als heilige Stätten betrachtet werden. Orte wie Mariazell in Österreich, Lourdes in Frankreich und Fatima in Portugal erleben in dieser Zeit eine hohe Anzahl an Pilgern. Viele dieser Stätten sind bekannt für Berichte über Marienerscheinungen, die den Glauben und die Hoffnung der Besucher stärken. Die Pilgerreisen im Mai sind oft geprägt von gemeinschaftlichen Gebeten, Bußgängen und spirituellen Erneuerungen. Sie bieten den Gläubigen die Möglichkeit, ihre persönlichen Anliegen vor die Muttergottes zu bringen und Trost sowie Heilung zu suchen. Die Wallfahrten im Marienmonat sind ein Ausdruck tiefer Frömmigkeit und eine Gelegenheit, den Glauben in Gemeinschaft zu leben und zu feiern.
Marienerscheinungen
Seit dem 18. Jahrhundert gelten Marienerscheinungen als "Privatoffenbarungen", die theologisch kontrovers diskutiert werden. Die katholische Kirche trennt streng zwischen göttlicher Offenbarung, die mit dem Tod des letzten Apostels endete, und Privatoffenbarungen, die lediglich die ursprüngliche Offenbarung erinnern, erklären oder aktualisieren können. Katholiken steht es frei, an diese Erscheinungen zu glauben oder nicht, selbst wenn die Kirche ihre Echtheit anerkennt. Der Vatikan hat kürzlich neue Normen zur Prüfung und Beurteilung mutmaßlicher übernatürlicher Phänomene veröffentlicht.
Lourdes: Ein Schema für spätere Erscheinungen?
Kritiker wie der Historiker David Blackbourn sehen im südfranzösischen Lourdes ein Modell für nachfolgende Marienerscheinungen. Hier erschien die "Unbefleckte Empfängnis" 1858 der Schafhirtin Bernadette Soubirous 18 Mal. Typisch sind dabei eine einfache Seherin aus armen Verhältnissen, eine fromme Botschaft, Heilwasser, der Bau eines Heiligtums und Berichte von Wunderheilungen. Nach anfänglicher Ablehnung durch die Kirche und Behörden etabliert sich schließlich ein offizieller kirchlicher Kult.
Von den Anfängen bis ins Heute
Berichte über Marienerscheinungen gibt es seit dem frühen Christentum. Bereits im Jahr 41 soll Maria dem heiligen Jakobus auf einer Säule erschienen sein. Im Mittelalter waren die Visionäre zumeist männliche Kleriker. Erst später änderte sich das Bild: Nun waren es oft Mädchen aus dem einfachen Volk, die als "Auserwählte" galten. Diese Erscheinungen traten häufig in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Krisen auf, etwa in den 1850er bis 1870er Jahren, während des Ersten Weltkriegs oder im Krisenjahr 1933.
Wirtschaftliche und politische Krisen als Hintergrund
Experten sehen einen Zusammenhang zwischen Marienerscheinungen und wirtschaftlichen sowie politischen Krisen. Beispiele sind das Alpendorf La Salette 1846, Lourdes 1858 und das saarländische Marpingen 1876. Die Häufung dieser Erscheinungen in Krisenzeiten deutet darauf hin, dass sie den Menschen Trost und Hoffnung spenden sollten.
Kirchliche Anerkennung: Eine Seltenheit
Obwohl es europaweit Hunderte von Marienerscheinungen gibt, wurden nur wenige kirchlich anerkannt. In Frankreich sind es beispielsweise La Salette-Fallavaux, Lourdes und Pontmain, die mit der Proklamation des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis in Verbindung stehen. Auch in Portugal wurden die Visionen von Fatima 1930 anerkannt, gefolgt von Beauraing 1932 und Banneux 1933. Seitdem hat keine weitere Erscheinung eine offizielle Genehmigung erhalten.
Medjugorje: Eine besondere Ausnahme
Ein Sonderfall ist Medjugorje in Bosnien-Herzegowina, wo die Marienerscheinungen angeblich seit dem 24. Juni 1981 bis heute andauern. Die Zahl der Berichte geht in die Zehntausende. Trotz zahlreicher Berichte und der großen Bedeutung für viele Gläubige steht eine offizielle kirchliche Anerkennung noch aus.
Marienerscheinungen in Österreich
Auch in Österreich gibt es zahlreiche Marienwallfahrtsorte mit Berichten von Marienerscheinungen. Bisher wurde aber noch keiner davon zu einem kirchlich anerkannten Erscheinungsort.
Marienerscheinungen bleiben ein faszinierendes und viel diskutiertes Phänomen innerhalb der katholischen Kirche, das gläubigen Menschen Trost und Hoffnung spendet und zugleich immer wieder zu theologischen Debatten führt.
Ankunft der Pilgerleitung in Lourdes
Seit Sonntag, dem 19. Mai 2024, ist die österreichische Pilgerleitung unter der Führung von Militärpfarrer Militärsuperior Oliver Hartl in Lourdes angekommen. Ihr Ziel: alle notwendigen Vorbereitungen für die 64. Internationale Soldatenwallfahrt (PMI) zu treffen, die am Donnerstag, dem 23. Mai 2024, beginnen wird.
Aufbau und Organisation vor Ort
Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen der Aufbau und die Organisation des österreichischen Pilgerbüros. Dazu gehören Absprachen mit den Vertretern anderer Nationen und die Koordination der Arbeiten des Aufbaukommandos im Zeltlager. Dieses Jahr wird das Aufbaukommando von den Salzburger Pionieren gestellt, die sich intensiv um die Infrastruktur und die logistische Unterstützung kümmern.
Stadtbesichtigung und spirituelle Vorbereitung
Neben den organisatorischen Aufgaben gab es auch einen Rundgang durch die Stadt Lourdes, bei dem die Mitglieder des Aufbaukommandos die wichtigsten Orte der bevorstehenden Wallfahrt besichtigten. Diese Erkundungstour diente nicht nur der Orientierung, sondern stärkte auch den Teamgeist und die Kameradschaft. Zur spirituellen Vorbereitung wurde zudem ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert.
Erwartete Ankunft der österreichischen Pilger
Die Vorfreude auf die Ankunft der österreichischen Teilnehmer ist groß. Insgesamt 400 Pilger, darunter 130 Soldaten und Rekruten aus allen Bundesländern, werden im erwartet. Die österreichische Pilgerleitung blickt freudig gespannt auf die bevorstehenden Tage und die Begegnungen während der Wallfahrt.
Die 64. Internationale Soldatenwallfahrt verspricht, erneut ein beeindruckendes Ereignis der Gemeinschaft und des Glaubens zu werden, bei dem Soldatinnen und Soldaten aus aus aller Welt zusammenkommen.
Die katholische Militärseelsorge trauert um Militärgeneralvikar i.R. Prälat Rudolf Schütz. Am Ende einer langen, geduldig ertragenen Krankheit starb Rudolf Schütz am 21. Mai 2024 im 86 Lebensjahr.
„In Trauer nehmen wir Abschied von Rudolf Schütz, der als Militärgeneralvikar im Dienst der Kirche und dem österreichischen Bundesheer eine tiefe Spur hinterlassen hat. Durch seinen Glauben und seine Herzlichkeit inspirierte er die Soldatinnen und Soldaten. Doch nicht nur seine Freundlichkeit, sondern auch seine Liebe zum Gesang haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In dieser Zeit des Abschieds sind unsere Gedanken und Gebete bei seiner Familie und seinen Freunden. Der Auferstandene schenke seinem Priester Rudolf Schütz die ewige Ruhe,“ so Militärbischof Werner Freistetter.
Rudolf Schütz wurde am 1. Februar 1939 in Wien geboren. Nach der Pflicht- und Realschulzeit absolvierte er von 1958 - 1959 seinen Präsenzdienst im Österreichischen Bundesheer und machte die Ausbildung zum Reserveoffiziersanwärter. Von 1959 - 1964 studierte er Theologie an der Universität Wien und war in der Bundeshauptstadt im Priesterseminar. Zwischendurch leistete er Waffenübungen beim Gardebataillon Wien und bei der Militärpfarre beim Militärkommando Wien und wurde infolgedessen zum Reserveoffiziersanwärter Wachtmeister befördert. 1964 empfing Rudolf Schütz die Priesterweihe im Stephansdom durch Kardinal Dr. Franz König. Von 1970 - 1985 war er als Militärpfarrer beim Militärkommando Niederösterreich für die Garnisonen Baden, Groß Enzersdorf, Hainburg, Klosterneuburg und Langenlebarn, kurzfristig auch für Leobendorf und Mistelbach zuständig. 1983 erfolgte die Ernennung zum Monsignore durch Papst Johannes Paul II. Von 1985 bis 1992 wirkte Schütz als Dekanatspfarrer beim Armeekommando in Wien. Ab 1987 war er als der Rektor der Krypta im österreichischen Heldendenkmal und ab 1989 als Rektor der Stiftskirche in Wien tätig. 1994 erfolgte dann die Ernennung zum Militärgeneralvikar des Militärordinariates der Republik Österreich durch Militärbischof Mag. Christian Werner bis 2004.
Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber
Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar...
WeiterlesenDie Insignien des neuen Bischof der Erzd…
Mit der Amtseinführung eines Bischofs treten Symbole in den Mittelpunkt, die weit mehr sind als liturgischer Schmuck. Die sogenannten Insignien...
WeiterlesenAdvent – Bedeutung und gelebte Tradition…
Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...
WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat
Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...
Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävention - gemeinsam ein Zeichen setzen
Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) jährlich an diesem Datum daran, wie…
Informationen aus der KircheChristophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli)
Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem im Straßenverkehr. Als Schutzpatron der Reisenden ziert sein Bild zahlreiche…
Informationen aus der KircheHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne
Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…
Informationen aus der Kirche
29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus
Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…
Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie
Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…
Informationen aus der KircheFronleichnam kurz gefasst
Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…
Informationen aus der Kirche
Pfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest
Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…
Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?
Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…
Informationen aus der Kirche14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los
Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…
Informationen aus der Kirche
- 1
- 2
- 3
Empfehlungen
Aschermittwoch: Der Beginn der Fastenzei…

Der Aschermittwoch stellt den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit im Christentum dar, die sich bis Ostern erstreckt. Seit dem 6. Jahrhundert wird der Mittwoch als Aschermittwoch bezeichnet, der vor dem sechsten... Weiterlesen
Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen
„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen
Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen
Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen
13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen
66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen
24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen
Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen
Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen
65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen
Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen
Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen
Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen
"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen
HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen
Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen
Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen
Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen
Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen
Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen
Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen
Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen
Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen
Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen
Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen
Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen
Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen
Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen
Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen
Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen
25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen