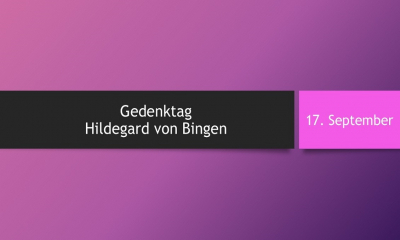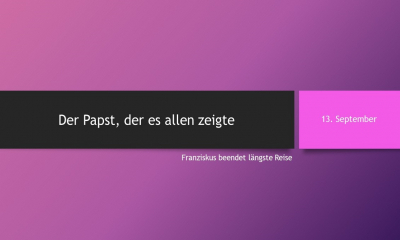Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Diözese
Aktuelles aus der Diözese
1.200 Soldatinnen und Soldaten des Bundesheers sind derzeit im Assistenzeinsatz in Niederösterreich aktiv. Unter ihnen befindet sich auch Militärsuperior Oliver Hartl. Es gilt, ein offenes Ohr für die Anliegen der Soldatinnen und Soldaten zu haben sowie Trost und Unterstützung zu bieten.
Papst Franziskus gedachte am Ende der Generalaudienz am Mittwoch der Opfer der Überschwemmungen in Europa und versicherte allen seine Nähe.
Die österreichischen Bischöfe und kirchlichen Einrichtungen haben erneut bekräftigt, dass die Katastrophe nicht allein durch materielle Hilfe bewältigt werden kann. Sie ersuchen um Solidarität, Zusammenhalt und ein offenes Herz für die Betroffenen – ein Aufruf, dem viele Österreicher bereits nachgekommen sind und der hoffentlich weiterhin viele Menschen zum Handeln bewegt.
In dieser schwierigen Zeit zeigt sich einmal mehr, dass die wahre Stärke einer Gesellschaft in ihrem Zusammenhalt, ihrer Hilfsbereitschaft und im Miteinander liegt.
Unwetter verursacht Jahrhundertflut in Ostösterreich
Die anhaltenden Regenfälle in Österreich zwischen dem 12. und 16. September 2024 haben in weiten Teilen des Landes eine Jahrhundertflut ausgelöst. Besonders betroffen sind die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark sowie Teile Wiens. In diesen Regionen fielen bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter – das Vier- bis Sechsfache der durchschnittlichen Monatsmenge für September. Tausende Haushalte stehen unter Wasser, zahlreiche Straßen sind unpassierbar, und die Gefahr von Dammbrüchen und Erdrutschen ist weiterhin hoch.
Die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Hochwasser werden noch Monate in Anspruch nehmen, nicht nur in Österreich, sondern auch in den Nachbarländern Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Deutschland und Polen, die ebenfalls von den Wassermassen betroffen sind.
Einsatzkräfte und Helfer im Dauereinsatz
Zehntausende Einsatzkräfte sind seit Tagen unermüdlich im Einsatz, um Menschen zu evakuieren und die Schäden einzudämmen. Freiwillige Feuerwehren, Rettungsdienste, Militär und Zivilschutzorganisationen arbeiten rund um die Uhr, um Dämme zu sichern, Menschen in Notlagen zu retten und die Wassermassen unter Kontrolle zu bringen.
Kirchliche Hilfe in der Krise
Inmitten dieser Katastrophe leistet die Kirche wichtige Unterstützung. Die Caritas und andere kirchliche Organisationen sind vor Ort aktiv, sammeln Spenden und bieten direkte Hilfe für die Betroffenen. Familien, die ihr Hab und Gut verloren haben, erhalten nicht nur materielle Hilfe, sondern auch psychologische und geistliche Unterstützung.
Besonders hervorzuheben ist die Telefonseelsorge, die unter der Nummer 142 einen erhöhten Bedarf an Gesprächen verzeichnet. Viele Menschen suchen in dieser Krisensituation Trost und jemanden, der ihnen zuhört. Die kirchliche Seelsorge steht bereit, um ihnen zur Seite zu stehen.
Aufruf zur Solidarität
Mehrere Bischöfe des Landes haben in ihren Diözesen zu Gebeten für die Betroffenen und die Einsatzkräfte aufgerufen. Kardinal Christoph Schönborn betonte in seiner Ansprache, wie wichtig es sei, in dieser schwierigen Zeit eine „große Welle der Menschlichkeit und des Zusammenhalts“ zu zeigen.
Die Kirche appelliert an die Solidarität der Bevölkerung und ruft zu Spenden für die Hochwasserhilfe auf. Jede Spende, ob groß oder klein, hilft den Menschen, die alles verloren haben, einen Neuanfang zu wagen.
Jetzt spenden und helfen
Wer den Opfern der Hochwasserkatastrophe helfen möchte, kann Spenden an die Caritas Österreich richten. Jede Spende trägt dazu bei, den betroffenen Familien schnelle und wirksame Unterstützung zu bieten.
Spendenkonto für die Hochwasserhilfe:
Caritas Österreich, Kennwort: Katastrophenhilfe Österreich
Erste Bank
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560
Mit Ihrer Hilfe können wir gemeinsam Hoffnung und Zuversicht in diesen schweren Zeiten spenden.
Die Heilige Hildegard von Bingen ist eine der bemerkenswertesten Frauen des Mittelalters. Sie war Mystikerin, Theologin, Naturheilkundige und Komponistin. Bis heute inspiriert ihr Werk zahlreiche Menschen, und ihr Leben hat sowohl spirituelle als auch wissenschaftliche Spuren hinterlassen. Am 17. September wird weltweit ihrer gedacht – eine Gelegenheit, die vielen Facetten dieser außergewöhnlichen Frau neu zu beleuchten.
Eine Kindheit im Kloster
Hildegard wurde 1098 im heutigen Rheinland-Pfalz als zehntes Kind einer adeligen Familie geboren. In dieser Zeit war es nicht unüblich, ein Kind Gott zu weihen. So wurde auch Hildegard schon als junges Mädchen in die Obhut des Benediktinerklosters Disibodenberg gegeben, wo sie unter der Anleitung von Jutta von Sponheim aufwuchs. Dort erhielt sie eine umfassende Bildung in den Bereichen Theologie, Heilkunst und Musik, die sie auf ihr späteres Wirken vorbereitete. Schon früh berichtete sie von mystischen Visionen, die sie ihr ganzes Leben lang begleiten sollten.
Der Auftrag: Hildegards Visionen
Ein Wendepunkt in ihrem Leben ereignete sich im Jahr 1141, als sie eine kraftvolle Vision empfing, die sie dazu aufforderte, ihre mystischen Erlebnisse niederzuschreiben. Anfangs war sie unsicher und zögerte, doch schließlich begann sie mit der Niederschrift ihrer Visionen in dem Werk "Scivias" („Wisse die Wege“). Darin beschreibt sie den göttlichen Auftrag, den sie empfangen hatte, und erzählt von ihren Einblicken in die Schöpfungsgeschichte und das Heilsgeschehen.
Ihre Visionen, gepaart mit tiefen theologischen Überlegungen, fanden schnell Gehör – auch bei der Kirchenführung. Papst Eugen III. erkannte ihre Schriften als von Gott inspiriert an, was Hildegard das Vertrauen und die Freiheit gab, ihre Lehren weiter zu verbreiten.
Die Gründung eines eigenen Klosters
Nach dieser päpstlichen Anerkennung setzte Hildegard einen bedeutenden Schritt: Sie gründete ein eigenes Kloster auf dem Rupertsberg bei Bingen. Hier entwickelte sie sich zur Universalgelehrten und verwirklichte ihre Vision eines spirituellen und intellektuellen Zentrums für Frauen. Sie nahm ihre Schwestern mit auf eine Reise zu geistiger Selbstständigkeit, bot aber auch weltlichen Menschen Rat in spirituellen und praktischen Fragen.
Der Begriff der „viriditas“, der „Grünkraft“, prägte viele ihrer Schriften. Für Hildegard war dies das Prinzip des Lebens selbst – die grüne, fruchtbare Energie, die alles in der Schöpfung durchdringt und belebt. Ihre Naturbeobachtungen und das Wissen um Heilpflanzen flossen in medizinische Schriften und Ernährungspläne ein, die den Menschen lehrten, Körper und Seele im Einklang zu halten.
Kritische Mahnerin und Beraterin der Mächtigen
Hildegard genoss nicht nur hohes Ansehen bei den Ordensschwestern und Gelehrten, sondern auch bei den Mächtigen ihrer Zeit. Ihre Korrespondenz mit Fürsten, Bischöfen und sogar Kaisern zeigt, wie mutig sie selbst Herrscher ermahnte. Ein berühmtes Beispiel ist ihr Brief an Friedrich Barbarossa, in dem sie ihn vor dem Missbrauch seiner Macht warnte. Trotz ihrer eindringlichen Worte wurde sie unter seinen persönlichen Schutz gestellt, was ihr große Freiheiten verschaffte.
Neben politischen Mahnungen sprach sie auch über ethische und kosmologische Fragen und setzte sich für den Schutz der Schöpfung ein – lange bevor Umweltschutz ein Thema war. Sie verstand die Erde als ein empfindliches System, das durch menschliches Handeln bewahrt werden muss.
Musik als spirituelle Brücke
Ein weiterer bedeutender Aspekt von Hildegards Wirken war die Musik. Sie komponierte zahlreiche geistliche Gesänge und Hymnen, die das Göttliche durch Klang erfahrbar machen sollten. In ihrer Musik sah sie eine Erinnerung an das verlorene Paradies, eine spirituelle Verbindung zwischen Himmel und Erde. Obwohl ihre Kompositionen nach ihrem Tod lange in Vergessenheit gerieten, wurden sie im späten 20. Jahrhundert neu entdeckt und erfreuen sich heute großer Beliebtheit.
Letzte Jahre und Vermächtnis
Die letzten Jahre ihres Lebens waren von einem Konflikt mit der Kirche geprägt. Hildegard ließ einen exkommunizierten Mann in ihrem Kloster bestatten, was zu einem Kirchenbann führte. Ihr standhafter Widerstand führte letztlich dazu, dass der Bann aufgehoben wurde. Kurz danach, im Jahr 1179, verstarb sie im Alter von 81 Jahren.
Trotz dieser schwierigen Zeiten hinterließ Hildegard ein reiches Vermächtnis. Ihr Wirken, das sich auf die Bereiche Theologie, Naturheilkunde, Musik und Politik erstreckte, beeindruckt bis heute. 2012 wurde sie von Papst Benedikt XVI. zur Kirchenlehrerin ernannt, eine seltene Ehre, die nur wenigen Frauen zuteilwird. Zudem wird seit 2021 der 17. September als ihr weltweiter Gedenktag in der katholischen Kirche gefeiert.
Hildegards Bedeutung heute
Hildegard von Bingen war eine außergewöhnliche Frau, die ihre Zeit weit hinter sich ließ. Ihr ganzheitlicher Blick auf das Leben, ihre unerschrockenen Mahnungen an die Mächtigen und ihre spirituelle Tiefe machen sie zu einer zeitlosen Figur. Besonders ihre Verbindung von spirituellem Wissen und Naturheilkunde sowie ihre Vision von einer harmonischen Schöpfung sind auch heute noch relevant. Hildegards Leben und Werk zeigen, wie sich Glaube und Vernunft, Spiritualität und Wissenschaft miteinander verbinden lassen – eine Botschaft, die auch im 21. Jahrhundert aktueller denn je ist.
Die verheerenden Unwetter der letzten Tage haben Teile Österreichs stark getroffen. Während Wassermassen und Stürme erhebliche Schäden anrichteten, ist es der gesellschaftliche Zusammenhalt, der Hoffnung schenkt. Vor allem die Caritas unter der Führung von Michael Landau rückt in den Vordergrund, um den Betroffenen zu helfen und ein starkes Signal für Solidarität und Mitverantwortung zu setzen.
Zusammenhalt in der Krise: Landau dankt Helfern
Bei einem emotionalen Gottesdienst im Wiener Stephansdom rief Caritas-Europa-Präsident Michael Landau dazu auf, gerade in schwierigen Zeiten gemeinsam für die Schwächsten einzustehen. „Halten wir zusammen und vergessen wir die Schwächsten nicht“, appellierte Landau, der sich tief bewegt über den Einsatz der zahlreichen Helfer zeigte. Sowohl Einsatzkräfte als auch freiwillige Helfer hätten unermüdlich daran gearbeitet, die Schäden des Unwetters zu bewältigen und den Betroffenen beizustehen.
„Gemeinsam werden wir auch diese schwierige Situation meistern“, betonte er in seiner Predigt. Dabei sei die Katastrophe nicht nur ein österreichisches Problem. „Die Klimakrise ist Realität – hier bei uns und noch viel mehr in anderen Teilen der Welt“, erklärte Landau. Besonders tragisch sei, dass jene, die am wenigsten zur Entstehung der Krise beigetragen haben, am meisten unter deren Folgen zu leiden hätten.
Klimakrise: Ein Appell für Veränderung
Die Klimakrise und ihre Folgen, die in den jüngsten Unwettern deutlich spürbar wurden, waren zentrales Thema in Landaus Worten. Er forderte ein Umdenken in der Gesellschaft und einen bewussteren Lebensstil. „Es geht letztlich um die Welt, in der wir leben wollen: eine Welt, die auf Freiheit, Gerechtigkeit und Respekt basiert.“
Im Hinblick auf die anstehenden Nationalratswahlen rief Landau die Gläubigen dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und wählen zu gehen. „Entscheiden Sie in Verantwortung vor Ihrem Gewissen“, forderte er auf, und sprach von einer Gesellschaft, die nicht auf Isolation und Abgrenzung setzen dürfe, sondern auf Zusammenhalt und Mitverantwortung, im Sinne der kommenden Generationen.
Die Rolle der Caritas: Hilfe für die Schwächsten
Während die Einsatzkräfte vor Ort gegen die Auswirkungen der Naturgewalten kämpfen, ist die Caritas mit voller Kraft im Einsatz, um die betroffenen Regionen zu unterstützen. In vielen Gemeinden sind Hilfsprojekte angelaufen, die von Freiwilligen getragen werden. „In Zeiten der Not zeigt sich das wahre Gesicht einer Gesellschaft“, betonte Landau und bedankte sich bei allen, die ihren Beitrag leisten – sei es durch konkrete Hilfe vor Ort oder durch Spenden.
Das Engagement der Caritas geht dabei weit über die Soforthilfe hinaus. „Es geht darum, langfristig Strukturen zu schaffen, die den Betroffenen den Weg zurück in ein normales Leben ermöglichen“, so Landau. Diese Hilfe sei dringend notwendig, da viele Menschen ihr Hab und Gut verloren haben und vor dem Nichts stehen. Doch es sei die Kraft der Gemeinschaft, die den Betroffenen Hoffnung gebe.
Frieden, Gerechtigkeit und Nächstenliebe: Werte für eine bessere Welt
Neben der akuten Nothilfe lenkte Landau den Blick auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge. Unter Verweis auf Erzbischof Gabriele Caccia, Vertreter des Vatikans bei den Vereinten Nationen, erklärte er, dass es die Grundwerte Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Freiheit seien, die eine „Kultur des Friedens“ schaffen könnten.
„Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg“, betonte Landau. Es gehe darum, Gerechtigkeit zu fördern, soziale Ungleichheiten zu bekämpfen und Nächstenliebe zu leben. Die positiven Errungenschaften der Globalisierung müssten gerechter verteilt werden, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen.
Besonders wichtig sei dabei, dass jeder Mensch – unabhängig von Herkunft oder sozialem Status – in seiner Würde anerkannt werde. „Ein Mensch ist ein Mensch, egal wo seine Wiege stand“, zitierte Landau und sprach damit auch die Herausforderungen durch Migration und Armut an, die weltweit eine Rolle spielen.
Politisches Engagement: Verantwortung übernehmen
Ein zentrales Anliegen Landaus war auch das politische Engagement der Bürger. „Bringen Sie sich ein, politisch im engeren und weiteren Sinn!“, appellierte er. Demokratie lebe von der Beteiligung der Menschen, und nur durch gemeinsames Handeln könne eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft entstehen.
Landau warnte vor einer „Zuschauerdemokratie“, in der die Menschen passiv blieben und die Verantwortung anderen überließen. Besonders in Zeiten von Krisen sei es wichtig, aktiv zu werden und Veränderungen zu bewirken.
Hoffnung auf eine bessere Zukunft
Trotz der Herausforderungen zeigte sich Landau zuversichtlich. „Wir haben ein funktionierendes Gemeinwesen“, sagte er, und betonte, wie wertvoll der Zusammenhalt in der Gesellschaft sei. Die Hilfe, die derzeit in den betroffenen Regionen geleistet wird, zeige, dass Solidarität kein leeres Wort sei. „Wir leben in Sicherheit und Frieden, und das ist alles andere als selbstverständlich.“
Sein abschließender Appell war klar: „Zusammenhalten und einander helfen!“ Nur so könne die Gesellschaft gestärkt aus der Krise hervorgehen – mit dem Blick auf eine Zukunft, die auf Gerechtigkeit, Freiheit und Respekt gegenüber der Schöpfung basiert.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Damit hatte niemand gerechnet: Im Asien-Pazifikraum absolviert Papst Franziskus die längste Auslandsreise seiner Amtszeit ohne Schwächen - Ist es vielleicht nicht die letzte, sondern gar eine neue Phase seiner Amtszeit?
Ein Papst am Ende. Sein Pontifikat so gut wie abgeschrieben. Das nächste Konklave nach Gesundheitskrisen des annähernd 88-Jährigen schon in Sicht. Seine Gegner nutzen jeden Moment der Schwäche, um dem Papst einen Mangel an Regierungsfähigkeit oder Schlimmeres zu unterstellen - und das Bild eines steuerlosen Kirchenschiffs mit 1,4 Milliarden Passagieren zu zeichnen. So tönte es zuletzt in mancher Analyse über Papst Franziskus.
Doch der argentinische Papst ist zäh. Den ultimativen Beweis dafür lieferte er mit der längsten Reise seiner nun schon über elfjährigen Amtszeit. Zwölf Tage lang besuchte er Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. Alle weit von Rom entfernt, in jedem eine andere Zeitzone. Das Wetter wechselte stetig, angenehm war es nie: heiß, windig, versmogt mit Luftfeuchtigkeit bis zu 90 Prozent.
Den Papst schienen die ungünstigen Begleitumstände kaum zu stören. Stoisch arbeitete er sich von Termin zu Termin, von Begegnung zu Begegnung. Seine Reden und Predigten kürzte er nicht - im Gegenteil. Regelmäßig verschoben sich Folgeveranstaltungen, weil Franziskus jedem seine Zeit geben möchte. Organisatoren wie Beobachter hatten mit einigen kurzfristigen Terminabsagen gerechnet.
Kraftschöpfende Begegnungen
Doch sind es genau diese Auftritte fern von Rom, die nicht nur den Menschen vor Ort, sondern vor allem Franziskus Kraft geben. Er findet dort eine Kirche an der Peripherie vor, die sich keinen Protz leisten kann. Er trifft Menschen, die sich darüber freuen, den Mann in Weiß zu sehen, der für sie der Stellvertreter Christi ist. Menschen, die nicht nur auf negative Seiten der Kirche schauen - auch weil sie auf ihre Unterstützung angewiesen sind. In manchen armen Ländern ist der katholische Global Player der Einzige, der die nötigste soziale Infrastruktur stellt. Zudem schenkt Franziskus jenen Aufmerksamkeit, die sie international nur selten bekommen und erfüllt den Anspruch, mit dem er 2013 angetreten ist: Das Oberhaupt einer Kirche der Armen zu sein.
In Papua-Neuguinea und Osttimor haben die Worte des Papstes Gewicht, wenn er vor Politikern Korruption anprangert und Priestern eine andere, demütigere Vorstellung von ihrem Beruf ans Herz legt. Er wurde von den Menschen gehört, wenn er sich gegen Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung aussprach, ein Ende von Armut, Arbeitslosigkeit und Drogenmissbrauch forderte. In Indonesien suchte er den Schulterschluss mit dem gemäßigten Islam gegen Intoleranz und religiösen Extremismus. Singapur führte er als beispielhaft für eine nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz an - der Klimawandel betrifft alle Gastländer intensiv.
Mag das Echo auf seinen Besuch in manchen Ländern intensiver sein als in anderen - seine Reise ist definitiv ein Erfolg. Bis zu seinem letzten Termin blieb Papst Franziskus kraftvoll. Nur bei seiner letzten Station in Singapur trug er seine Reden eher rasch und ohne Improvisationen vor - vielleicht ein Zeichen der Erschöpfung am Ende dieses unglaublichen Marathons.
Nächste Reise nach Belgien und Luxemburg
Wenig deutet darauf hin, dass die Reise ans Ende der Welt eine finale Abschiedstournee war. Schon in zwei Wochen reist Franziskus nach Belgien und Luxemburg. Ein Besuch anlässlich des Jubiläums des Konzils von Nizäa in der Türkei im nächsten Jahr gilt als wahrscheinlich, eine Teilnahme an der Eröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame im Dezember ist nicht ausgeschlossen. Schon im Oktober tagt in Rom die Weltsynode - das Lieblingsprojekt des Papstes für eine grundlegende Kirchenreform, und zu Weihnachten eröffnet er das größte katholische Pilgerevent, das Heilige Jahr 2025.
Schafft er all das ebenso wie die anstrengende Südostasien-Ozeanien-Reise, könnten auch die fast schon abgeschriebenen Besuche in Indien und Argentinien vielleicht doch noch stattfinden.
Quelle: Von Kathpress-Korrespondentin Severina Bartonitschek, kathpress
Eucharistie und die verwundete Welt: Globale Herausforderungen im Fokus
Unter dem Motto "Geschwisterlichkeit zur Rettung der Welt" versammeln sich in dieser Woche über 6.000 Teilnehmer aus 53 Ländern in Quito, Ecuador, zum 53. Eucharistischen Weltkongress. Bei diesem bedeutenden katholischen Großereignis, das alle vier Jahre stattfindet, werden drängende globale Fragen wie Klimawandel, Kriege, Korruption und Armut aus religiöser Perspektive beleuchtet.
Bereits an den ersten beiden Kongresstagen, Montag und Dienstag, widmeten sich Vorträge dem Thema "verwundete Welt". Der spanische Filmemacher Juan Manuel Cotelo eröffnete den Kongress mit eindrücklichen Worten über die Bedeutung der Nächstenliebe und Vergebung. Er sprach davon, dass Jesus die Welt nicht verurteile, sondern rette, und betonte, wie wichtig es sei, „die rettende Quelle des Evangeliums und der Eucharistie“ in die verwundete Welt zu tragen. Cotelo erinnerte daran, dass der „Kleinste der Mächtigste“ sei und die Überwindung von Egoismus der Schlüssel zu einem friedlichen Zusammenleben darstelle.
Umweltkrise und Klimawandel: Ein Aufruf zur Verantwortung
Die ökologische Krise und der Klimawandel standen ebenfalls im Mittelpunkt der Diskussionen. Der brasilianische Erzbischof Jaime Spengler, Präsident des Lateinamerikanischen Bischofsrates, verwies auf die enge Verbindung zwischen dem christlichen Glauben und der Verantwortung für die Schöpfung. Der Verlust der Heiligkeit der Natur sei ein Grund für die aktuelle Umweltkrise. Spengler betonte, dass die Eucharistie keine Distanz zur Welt schaffe, sondern vielmehr Gemeinschaft und Verantwortung fördere.
Gesellschaftliche Wunden: Korruption und Ungerechtigkeit
Rodrigo Guerra, Sekretär der Päpstlichen Lateinamerika-Kommission, und Quitos Bürgermeister Pabel Muñoz sprachen über die „gesellschaftlichen Wunden“, die besonders in lateinamerikanischen Städten sichtbar sind. Themen wie Korruption, Konsumismus und soziales Unrecht wurden aus der Perspektive des christlichen Glaubens beleuchtet. Beide Redner hoben die Kraft des Glaubens hervor, Herzen und Realitäten zu verändern, indem man sich an Geschwisterlichkeit und Menschlichkeit orientiere.
Der Krieg in der Ukraine: Eucharistie als Quelle der Widerstandskraft
Auch der Krieg in der Ukraine fand auf dem Weltkongress Gehör. Weihbischof Hryhorij Komar aus der Ukraine betonte die spirituelle Stärke seines Landes und erklärte, dass die Widerstandsfähigkeit gegen die russische Invasion aus der Einheit mit Gott und der Eucharistie stamme. Der Bischof rief die Anwesenden eindringlich dazu auf, für die Ukraine zu beten und hob die heilende Kraft des Glaubens in Zeiten des Krieges hervor.
Revolution der Zärtlichkeit: Eine Theologie der Umkehr
Die argentinische Theologin Sr. Daniela Cannavina sprach in ihrem Vortrag über die „Revolution der Zärtlichkeit“, die von der Eucharistie ausgehe. Die Begegnung mit Jesus in der Heiligen Kommunion führe zu einer Umkehr hin zu universeller Geschwisterlichkeit. Diese Transformation verwandle Macht in Dankbarkeit und Gleichgültigkeit in Solidarität. Ihre Worte zeichneten ein Bild der Hoffnung, dass die Welt durch die Liebe Gottes geheilt werden könne.
Persönliche Glaubenszeugnisse: Schicksale, die Hoffnung spenden
Neben theologischen Vorträgen bot der Kongress auch Raum für persönliche Glaubenszeugnisse. Margaret Fellker aus den USA berichtete von ihrem Sohn David, der 2002 in Ecuador verschwand. Die tragische Suche nach ihrem Sohn verwandelte sich in eine Mission der Nächstenliebe. Mit ihrem Mann gründete sie das Hilfswerk „David's Educational Opportunity Fund“, das benachteiligten Jugendlichen in Ecuador Bildungschancen bietet.
Ein globales Großereignis: Begegnung im Zeichen der Eucharistie
Der Eucharistische Weltkongress zählt neben den Weltjugendtagen zu den größten katholischen Veranstaltungen weltweit. Seit 1881 finden diese Kongresse an wechselnden Orten statt, um die zentrale Bedeutung der Eucharistie in der katholischen Kirche zu stärken. Der diesjährige Veranstaltungsort Quito wurde von Papst Franziskus anlässlich des 150. Jahrestages der Herz-Jesu-Weihe der Stadt ausgewählt.
Eröffnet wurde der Kongress am Sonntag mit einer festlichen Messe, an der 40.000 Gläubige teilnahmen. In den kommenden Tagen werden unter anderem Vorträge über das „Heiligste Herz Jesu“ und die Bedeutung der Eucharistie gehalten. Den Höhepunkt bildet eine feierliche Messe mit anschließender Prozession am Samstag durch Quitos historische Altstadt.
Mit der Bekanntgabe des Austragungsortes des nächsten Kongresses im Jahr 2028 endet das Großereignis am Sonntag feierlich.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Singapur, 12. September 2024 – Bei seinem historischen Besuch in Singapur hat Papst Franziskus eindringlich dazu aufgerufen, die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen. Vor rund 1.000 Vertretern aus Politik, Diplomatie und Zivilgesellschaft hob er besonders die Bedeutung der Unterstützung von älteren Menschen und Gastarbeitern hervor. In einem der reichsten Länder der Welt, das für seine wirtschaftliche Stärke bekannt ist, betonte Franziskus die moralische Verantwortung, auch jene zu schützen, die am wenigsten vom Fortschritt profitieren.
Würdigung der Älteren und Gastarbeiter
Papst Franziskus richtete seinen Appell an die politische Führung des Stadtstaats und forderte, ältere Menschen nicht zu vergessen, „deren Mühen den Grundstein für das Singapur von heute gelegt haben“. Gleichzeitig hob er die Rolle der rund 1,5 Millionen Gastarbeiter hervor, die einen bedeutenden Beitrag zum Aufbau der Gesellschaft leisten. „Diese Menschen verdienen nicht nur Respekt, sondern auch einen angemessenen Lohn“, mahnte Franziskus. Viele der Arbeitsmigranten kommen aus Ländern wie Indien, Myanmar oder Bangladesch und sind oft in prekären Beschäftigungen tätig.
Soziale Gerechtigkeit und Gefahr der Ausgrenzung
Ein zentrales Anliegen des Papstes war die Mahnung, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht zur Ausgrenzung der Schwächsten führen dürfe. Singapur müsse seine Bemühungen um soziale Gerechtigkeit fortsetzen, bis alle Einwohner gleichberechtigt daran teilhaben könnten. „Ein übersteigerter Pragmatismus und eine zu starke Betonung der Leistung könnten ungewollt dazu führen, dass diejenigen, die nicht am Fortschritt teilhaben, ausgeschlossen werden“, warnte der Papst.
Fortschritt und Menschlichkeit in Balance
Obwohl Franziskus das hohe Entwicklungsniveau des Stadtstaats lobte – Singapur ist bekannt für seine moderne Architektur und technologische Innovationen – erinnerte er daran, dass menschliche Beziehungen im Zentrum jeder Gesellschaft stehen sollten. Die beeindruckende Nutzung künstlicher Intelligenz und modernster Technologien dürfe nicht dazu führen, dass „reale und konkrete menschliche Beziehungen“ vernachlässigt werden.
Dialog und Respekt als Grundlage der Stabilität
In einem Land, das ein harmonisches Miteinander von verschiedenen Ethnien, Kulturen und Religionen lebt, lobte der Papst den interkulturellen und interreligiösen Dialog. Singapurs Fähigkeit, Extremismus und Intoleranz zu verhindern, sei beispielhaft. Franziskus betonte, dass gegenseitiger Respekt und Zusammenarbeit entscheidende Faktoren für den Erfolg und die Stabilität des Landes sind. Dieser Dialog schaffe nicht nur Frieden innerhalb des Landes, sondern trage auch zur internationalen Ordnung bei.
Singapur als Vorbild in einer unruhigen Welt
Papst Franziskus rief die politische Führung Singapurs dazu auf, weiterhin eine wichtige Rolle in der internationalen Gemeinschaft zu spielen. „In einer Welt, die von Konflikten und Kriegen bedroht ist, ermutige ich Sie, sich für die Einheit und Brüderlichkeit der Menschheit einzusetzen“, sagte er. Er appellierte an die Führung des Landes, nicht nur nationale Interessen zu verfolgen, sondern sich für das Wohl aller Völker einzusetzen.
Präsident würdigt religiöse Vielfalt
In seiner Begrüßungsrede hob Singapurs Präsident Tharman Shanmugaratnam die wichtige Rolle der religiösen Gemeinschaften im Land hervor. Er würdigte insbesondere den Beitrag der katholischen Kirche in den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen. „Unsere ältesten katholischen Schulen haben Generationen von Singapurern inspiriert und geprägt“, sagte er und unterstrich die Bedeutung der ethnischen und religiösen Vielfalt als „zentralen Pfeiler unserer nationalen Identität“.
Nachhaltigkeit als Schlüsselthema
Ein weiteres zentrales Thema der Ansprache war die Nachhaltigkeit. Präsident Shanmugaratnam betonte, dass die ökologische Verantwortung seit der Unabhängigkeit Singapurs im Jahr 1965 eine Schlüsselrolle spielt. Mit dem „Singapore Green Plan 2030“ habe das Land einen umfassenden Leitfaden zur Bekämpfung der Klimakrise geschaffen. Papst Franziskus lobte das Engagement Singapurs im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und rief zu einer globalen Verantwortung auf. Innovationen, die aus Singapur stammen, könnten dem Wohl der gesamten Menschheit zugutekommen, so Franziskus.
Abschließende Geste: Eine Orchidee für den Papst
Zum Abschluss des Besuchs wurde eine Orchideenzüchtung enthüllt, die zu Ehren von Papst Franziskus benannt wurde – eine symbolische Geste, die den Besuch des Papstes in Singapur feierlich abrundete.
Singapur war die letzte Station der zweiwöchigen Asien-Pazifik-Reise des Papstes. Am Nachmittag wird Franziskus noch eine Stadionmesse feiern, bevor er nach weiteren Begegnungen mit Jugendlichen und Senioren am Freitag nach Rom zurückkehrt.
Fazit: Eine klare Botschaft des Papstes
Mit seinem Besuch in Singapur sendete Papst Franziskus eine klare Botschaft: Der wirtschaftliche Erfolg darf nicht auf Kosten der Schwächsten gehen. Dialog, Respekt und soziale Gerechtigkeit müssen in einer modernen Gesellschaft an erster Stelle stehen. Singapur, so der Papst, könne als Vorbild dienen – sowohl im Bereich der technologischen Innovation als auch im Engagement für den Schutz der Umwelt und der menschlichen Würde.
Papst Franziskus hat am Mittwochmorgen, 11. September 2024, in Osttimor bei einem emotionalen Jugendtreffen eine inspirierende Botschaft an rund 3.000 junge Menschen gerichtet. Dabei ermutigte er sie, Großes zu träumen und für Freiheit, Engagement und Geschwisterlichkeit einzutreten. Zugleich warnte er vor den Gefahren moderner Technologien und forderte dazu auf, sich nicht von Handys „versklaven“ zu lassen.
Jugend Osttimors im Fokus
Osttimor ist ein junges Land: Etwa 46 Prozent der Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt. Doch viele Kinder und Jugendliche kämpfen mit schwierigen Bedingungen wie Armut, Gewalt und mangelnder Schulbildung. „Ihr seid die Zukunft dieses Landes“, betonte Franziskus und forderte die Jugendlichen auf, inmitten dieser Herausforderungen mutig zu bleiben und nach vorne zu blicken. „Macht ruhig Lärm und träumt Großes“, ermunterte er die Anwesenden, während er die Bedeutung von Versöhnung und Miteinander hervorhob.
Die Gefahr der Technologie – Jugendliche melden sich zu Wort
Ein zentrales Thema des Treffens war der Einfluss moderner Technologien auf das Leben der Jugendlichen. Cecilia Efranio Bonaparte, eine junge Frau aus Osttimor, brachte es auf den Punkt: „In der heutigen technologisierten Welt geht die Rolle der Familie als Zentrum des Glaubens verloren, weil jeder mit seinem Handy beschäftigt ist. Die, die nah sind, werden fern und die, die fern sind, werden nah.“ Auch Ilham Mahfot Bazher, ein junger Muslim, äußerte Bedenken: „Soziale Medien beeinflussen die Menschen, sich gegenseitig schlecht zu behandeln und sogar zu diskriminieren.“
Franziskus nahm diese Themen auf und warnte eindringlich davor, sich durch das Handy „versklaven“ zu lassen oder nach trügerischem Glück durch Alkohol und Drogen zu suchen. „In eurer Geschichte gibt es wunderbare Beispiele des Heldentums, des Glaubens, der Vergebung und der Versöhnung“, erinnerte er die Jugendlichen. „Seid die Erben dieser Geschichte und führt sie mutig fort.“
Geschwisterlichkeit statt Feindschaft
Der Papst appellierte an die Jugendlichen, in ihrem Freiheitsstreben nie den Respekt vor anderen Religionen zu verlieren. „Seid Geschwister und nicht Feinde!“ Franziskus betonte die Bedeutung der Geschwisterlichkeit, einer der drei Haltungen, die er besonders hervorhob – neben Freiheit und Engagement. Auch die Verantwortung für das „gemeinsame Haus“, also den Schutz der Umwelt, sei eine Aufgabe, die sie übernehmen sollten.
Franziskus unterstrich die Rolle von Träumen für junge Menschen: „Ein junger Mensch, der nicht träumt, ist innerlich bereits ein Pensionist.“ Er erinnerte die Jugendlichen daran, dass sowohl Großeltern als auch Kinder die „Schätze“ einer Gesellschaft seien und besondere Fürsorge bräuchten.
Abschied von Osttimor – Weiterreise nach Singapur
Nach diesem bewegenden Treffen setzte der Papst seine Reise fort. Als letzte Station seiner knapp zweiwöchigen Tournee durch den Asien-Pazifikraum stand ein Besuch in Singapur an. Am frühen Mittwochnachmittag (Ortszeit) wird er in dem wohlhabenden Stadtstaat erwartet, der knapp zweimal so groß ist wie Wien und eine extrem hohe Bevölkerungsdichte aufweist.
Diese Reise, die ihn bereits nach Indonesien, Papua-Neuguinea und Osttimor geführt hat, markiert die bisher längste Auslandsreise seines Pontifikats. Am Freitag kehrt Papst Franziskus nach Rom zurück.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Mit einer eindrucksvollen Eröffnungsmesse und einer Botschaft von Papst Franziskus ist der 53. Eucharistische Weltkongress in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito gestartet. Die alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung zählt zu den größten katholischen Events und versammelte in diesem Jahr über 25.000 Gläubige aus 54 Ländern. Besonders im Fokus stand das Thema Geschwisterlichkeit und Solidarität, das der Papst in seiner Videobotschaft aufgriff. Dabei erinnerte er an das beispielhafte Wirken der Tiroler Ordensfrau Sr. Angela Autsch, auch bekannt als der „Engel von Auschwitz“.
Ein globales Glaubensfest in Ecuador
Am Sonntagmorgen fand der Auftakt des Kongresses im Parque Bicentenario in Quito statt. Die feierliche Eröffnungsmesse wurde von Erzbischof Alfredo Jose Espinoza Mateus geleitet. In einer besonderen Zeremonie empfingen 1.700 Kinder ihre Erstkommunion, begleitet von Tausenden Gläubigen aus der ganzen Welt. Aus Österreich reiste eine Delegation unter der Führung von Bischof Josef Marketz an, der einen besonderen Bezug zu Ecuador hat: Vor mehr als 40 Jahren verbrachte er dort sein Diakonatsjahr und betonte die prägende Wirkung dieser Zeit für sein späteres seelsorgerisches Wirken.
Der Weltkongress, der noch bis zum Sonntag andauert, ist neben den Weltjugendtagen eine der größten katholischen Veranstaltungen weltweit. Diese Kongresse finden seit 1881 an wechselnden Orten statt und sollen die Bedeutung der Eucharistie im Leben der Kirche stärken.
Papst Franziskus: Geschwisterlichkeit zur Heilung der Welt
In seiner Videobotschaft, die während der Messe eingespielt wurde, ging Papst Franziskus auf das zentrale Thema des Kongresses ein: „Geschwisterlichkeit zur Heilung der Welt“. Der Papst betonte, dass wahre Geschwisterlichkeit nur aus der tiefen Verbindung mit Gott entstehen könne und sie eine wesentliche Grundlage für eine gerechtere und menschlichere Welt sei. Diese Botschaft erhält angesichts globaler Krisen und sozialer Ungleichheiten eine besondere Dringlichkeit.
Sr. Angela Autsch: Ein Vorbild des Widerstands
Eine bewegende Passage der päpstlichen Botschaft widmete sich Sr. Angela Autsch, einer deutschen Ordensfrau, die 1944 im Konzentrationslager Auschwitz starb. Der Papst hob ihr mutiges Handeln hervor, das sie bereits vor ihrer Verhaftung durch die Nationalsozialisten zeigte. Sie ermutigte andere, trotz großer Gefahr regelmäßig die Eucharistie zu empfangen und sich im Gebet für die verfolgte Kirche einzusetzen. Diese spirituelle Praxis sah sie als eine Form des Widerstands gegen das Böse.
Sr. Autsch, die ursprünglich aus Tirol stammte, hatte sich während des NS-Regimes durch ihr diplomatisches Geschick gegen die Enteignung ihres Konvents gewehrt. Sie wurde 1940 von der Gestapo verhaftet und nach Aufenthalten in verschiedenen Gefängnissen schließlich ins KZ Auschwitz deportiert. Dort setzte sie sich bis zu ihrem Tod mit unglaublicher Hingabe für ihre Mithäftlinge ein. Ihr seliger Einfluss und ihre Menschlichkeit überdauern bis heute, und Papst Franziskus ehrte sie als „Engel von Auschwitz“.
Missionare der Geschwisterlichkeit
Erzbischof Espinoza forderte in seiner Predigt besonders die Kinder auf, die ihre Erstkommunion empfingen, zu „eucharistischen Missionaren“ zu werden. Er betonte, dass die Heilige Kommunion eine tiefe Verbindung zu Jesus schaffe und diese Freundschaft durch das Teilen der Freude mit anderen weitergegeben werden müsse. Der Erzbischof appellierte an die Gläubigen, als „Missionare der Geschwisterlichkeit“ auf das Leid der Armen zu achten und sich aktiv für deren Heilung und Unterstützung einzusetzen.
Eine lange Tradition der Eucharistischen Weltkongresse
Der Eucharistische Weltkongress blickt auf eine über hundertjährige Geschichte zurück. Seit 1881 wird er an wechselnden Orten weltweit ausgerichtet, um die zentrale Bedeutung des Sakraments der Eucharistie zu feiern und das Bewusstsein dafür zu fördern. Der erste Kongress wurde von der Französin Emilie Tamisier in Lille organisiert, inspiriert vom heiligen Priester Peter Julian Eymard. Seitdem hat sich die Veranstaltung zu einem bedeutenden Treffen der katholischen Weltgemeinschaft entwickelt.
Der Kongress in Quito wurde aus einem besonderen Anlass gewählt: Vor 150 Jahren wurde die ecuadorianische Hauptstadt dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht. Zuletzt fand ein Eucharistischer Weltkongress im Jahr 2004 in Lateinamerika statt, damals in Mexiko. Die Wahl von Quito als Austragungsort unterstreicht die Bedeutung der lateinamerikanischen Kirche für die globale katholische Gemeinschaft.
Der Weg des Kongresses
Der letzte Eucharistische Weltkongress wurde 2021 in Budapest abgehalten, nachdem er aufgrund der Pandemie von 2020 verschoben werden musste. In den Jahren davor war Cebu (2016), Dublin (2012) und Quebec (2008) Gastgeber des internationalen Glaubensfestes. Die Kongresse bieten eine einzigartige Plattform für Gläubige, um über die Bedeutung der Eucharistie nachzudenken, zu beten und sich mit anderen auszutauschen.
Der 53. Eucharistische Weltkongress in Quito stellt nicht nur die Feier der Eucharistie in den Mittelpunkt, sondern auch den Auftrag, durch Geschwisterlichkeit und Solidarität zu einer besseren Welt beizutragen – ein Anliegen, das Papst Franziskus unermüdlich verfolgt.
Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA
Am 8. September feiert die katholische Kirche das Fest Maria Geburt, das an die Geburt der Mutter Jesu erinnert. Diese Feier steht am Anfang eines dichten Netzes von Marienfesten im Kirchenjahr, das die besondere Rolle Mariens in der Heilsgeschichte betont. Trotz des Fehlens genauer historischer Daten zur Geburt Mariens markiert der 8. September diesen wichtigen Moment im Leben der Gottesmutter und wurde im 7. Jahrhundert von Papst Sergius I. auch im Westen eingeführt.
Die Geburt Mariens: Eine Geschichte der Hoffnung
Die Geschichte von Marias Geburt stammt aus apokryphen Schriften wie dem Protoevangelium des Jakobus und späteren Texten wie dem Pseudo-Matthäus-Evangelium. In diesen Erzählungen erfahren wir von ihren Eltern, Anna und Joachim, die lange kinderlos blieben und deren Glaube durch Unfruchtbarkeit auf die Probe gestellt wurde. Joachim zog sich verzweifelt in die Wüste zurück, und auch Anna betete unermüdlich zu Gott. Schließlich erschien beiden ein Engel und kündigte die Geburt einer Tochter an, die den Namen Maria tragen und eine besondere Bestimmung haben würde.
Das Paar versöhnte sich am Goldenen Tor von Jerusalem, und Maria wurde bald darauf geboren. Sie wuchs in einem frommen Zuhause auf, wo sie von ihrer Mutter Anna in Gebet und Gottesfurcht unterrichtet wurde. Später wurde sie in den Tempel gebracht, um dort unter der Aufsicht der Priester ihre Berufung weiter zu entdecken. Diese frühe Lebensgeschichte zeigt Maria als die „Auserwählte“, die schon von Kindheit an eine außergewöhnliche Verbindung zu Gott hatte.
Warum feiern wir Mariä Geburt am 8. September?
Die Wahl des 8. September für dieses Fest hat ihren Ursprung im 4. Jahrhundert, als die Basilika St. Anna in Jerusalem an der Stelle errichtet wurde, an der die Eltern Mariens gelebt haben sollen. Im Osten wurde das Fest schon damals gefeiert und breitete sich schließlich auch im Westen aus. Obwohl es keine präzisen historischen Angaben zum tatsächlichen Geburtsdatum Mariens gibt, wurde dieser Tag in der Tradition fest verankert. Er symbolisiert die Geburt der Frau, die die Menschheitsgeschichte verändern sollte, indem sie als Mutter Jesu zur Mittlerin zwischen Gott und den Menschen wurde.
Mariä Geburt und die Symbolik der Schwalben
Eine alte Bauernregel verknüpft Mariä Geburt mit dem Zug der Schwalben, die um den 8. September herum in den Süden fliegen. Bereits unsere Vorfahren beobachteten, dass die Schwalben um Maria Verkündigung im März zurückkehren und im September wieder fortziehen. Daraus entstand die Tradition, die Schwalbe als Symbolvogel der Muttergottes zu verehren, als Zeichen von Reinheit und Hoffnung.
Verehrung und Brauchtum rund um Mariä Geburt
Das Fest Mariä Geburt wird in einigen Regionen bis heute mit besonderen Bräuchen begangen. Während es in vielen Teilen Deutschlands kaum noch eine Rolle spielt, wird es in den Alpenregionen weiterhin feierlich begangen. Außerdem markiert der 8. September den Termin für den traditionellen Almabtrieb und Viehmärkte.
Die Bedeutung Mariens im Glauben
Maria, die „voll der Gnade“, wird in der Kirche als die Mutter aller Gläubigen verehrt. Als von der Erbsünde Befreite steht sie im Zentrum des Heilsplans Gottes. In ihrer Demut und Hingabe nahm sie die außergewöhnliche Aufgabe an, die Mutter Jesu zu sein. Dieser Gehorsam gegenüber dem göttlichen Willen macht sie zum Urbild der Kirche und zum Vorbild für alle Christen. Die Vielzahl an Marienfesten im Kirchenjahr – von Mariä Verkündigung bis Mariä Himmelfahrt – erinnert an ihre zentrale Rolle in der Erlösungsgeschichte.
Die Jungfrau Maria als Hoffnungsträgerin
In der christlichen Tradition wird Maria als Mittlerin zwischen den Menschen und Gott angesehen, die alle Leiden der Menschheit vor den Vater bringt. Ihre einzigartige Verbindung zu Jesus, ihrem Sohn und dem Erlöser, macht sie zu einer der wichtigsten Figuren im Glauben. Ihr Ja zu Gott hat nicht nur das Leben der Gläubigen, sondern die Geschichte der Menschheit geprägt.
weitere...
Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber
Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar...
WeiterlesenDie Insignien des neuen Bischof der Erzd…
Mit der Amtseinführung eines Bischofs treten Symbole in den Mittelpunkt, die weit mehr sind als liturgischer Schmuck. Die sogenannten Insignien...
WeiterlesenAdvent – Bedeutung und gelebte Tradition…
Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...
WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat
Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...
Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävention - gemeinsam ein Zeichen setzen
Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) jährlich an diesem Datum daran, wie…
Informationen aus der KircheChristophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli)
Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem im Straßenverkehr. Als Schutzpatron der Reisenden ziert sein Bild zahlreiche…
Informationen aus der KircheHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne
Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…
Informationen aus der Kirche
29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus
Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…
Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie
Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…
Informationen aus der KircheFronleichnam kurz gefasst
Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…
Informationen aus der Kirche
Pfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest
Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…
Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?
Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…
Informationen aus der Kirche14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los
Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…
Informationen aus der Kirche
- 1
- 2
- 3
Empfehlungen
Aschermittwoch: Der Beginn der Fastenzei…

Der Aschermittwoch stellt den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit im Christentum dar, die sich bis Ostern erstreckt. Seit dem 6. Jahrhundert wird der Mittwoch als Aschermittwoch bezeichnet, der vor dem sechsten... Weiterlesen
Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen
„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen
Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen
Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen
13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen
66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen
24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen
Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen
Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen
65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen
Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen
Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen
Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen
"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen
HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen
Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen
Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen
Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen
Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen
Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen
Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen
Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen
Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen
Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen
Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen
Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen
Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen
Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen
Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen
Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen
25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen