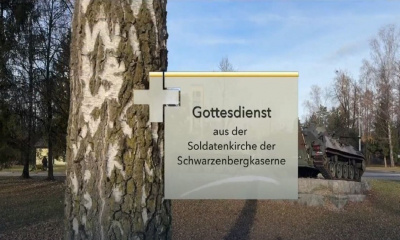Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Katholische Militärseelsorge
Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich
Am 19. Dezember fand in der Haspinger-Kaserne in Lienz die dritte und zugleich letzte Rorate des Jahres 2025 statt. Wie beliebt diese frühmorgendlichen Feiern sind, zeigte sich deutlich an der großen Beteiligung: Mehr als 100 Besucherinnen und Besucher nahmen an der feierlichen Roratemesse sowie am anschließenden gemeinsamen Frühstück teil.
Musikalisch gestaltet wurde die Rorate vom Chor „Die Schattseitner“, der der Feier einen stimmungsvollen Rahmen verlieh. Den Gottesdienst zelebrierte Diakon Michael Brugger.
Ein besonderer Dank gilt dem ehemaligen Kommandanten des Jägerbataillons 24, Oberst des Generalstabsdienstes Wasinger, der eigens aus Laibach angereist war und mit seiner Teilnahme seine enge Verbundenheit zum Verband unterstrich.
Mit dieser gut besuchten Feier fanden die Roraten 2025 einen würdigen Abschluss.
Am 16. Dezember feierte Militäroberkurat Christoph Gmachl-Aher in der Andreas Hofer-Kaserne in Absam einen vorweihnachtlichen Gottesdienst. Gemeinsam mit aktiven und ehemaligen Bediensteten der Garnison Absam sowie Vertreterinnen und Vertretern der Exekutive wurde innegehalten und Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr gehalten.
Im Mittelpunkt stand der Dank für ein Jahr, das - zumindest in Österreich - in Frieden und Freiheit erlebt werden durfte – für ein Jahr ohne größere Hilfseinsätze, geprägt von Stabilität sowie zahlreichen positiven Entwicklungen und Inhalten im dienstlichen Alltag. Der Gottesdienst bot Raum für Besinnung, Gemeinschaft und gelebte Kameradschaft.
Die Militärmusik Tirol sorgte für die feierliche musikalische Umrahmung. Im Anschluss lud man zur gemeinsamen Weihnachtsfeier, bei der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stärkten und den Vormittag in gemütlicher Atmosphäre mit angenehmen Gesprächen ausklingen lassen konnten.
Am 11. Dezember 2025 wurde die umfassende Verwaltungsstrukturreform der Katholischen Militärseelsorge Österreich feierlich unterzeichnet. Militärbischof Dr. Werner Freistetter, Militärgeneralvikar Mag. Peter Papst und Militärerzdekan Dr. Harald Tripp bestätigten jene Dekrete und Ordnungen, die in den vergangenen zwölf Monaten unter Leitung von Dipl. Theol. David Gomolla von einem interdisziplinären Expertenteam erarbeitet wurden. Die Reform tritt für zwei Jahre ad experimentum in Kraft.
Die Neuordnung betrifft ausschließlich die kirchenrechtliche Struktur der Militärdiözese und stellt einen Meilenstein dar, da klare Zuständigkeiten, Transparenz und moderne Verwaltungsstrukturen geschaffen werden. Zentrales Element ist die organisatorische Trennung der Militärdiözese vom nunmehr so benannten „Bischöflichen Versorgungsfonds“.
In den kommenden Monaten folgen weitere organisatorische Schritte, um die Zusammenarbeit effizient zu gestalten und die Reform gemeinsam mit den Militärseelsorgern und Mitarbeitenden umzusetzen.
Zum traditionellen Kärntner Adventkonzert in der St.-Georgs-Kathedrale luden die Angehörigen der Militärpfarre (MPGR) sowie der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) an der Theresianischen Militärakademie ein.
Am dritten Adventsamstag, dem Vorabend von Gaudete, dem Sonntag der Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest, gestalteten die Villacher Sängerunde Fellach Oberdörfer bereits zum fünften Mal, das Wiener Neustädter Instrumentalensemble „Johannas Hausmusik“ zum zweiten Mal sowie Obst i. R. Ing. Hugo Schuller mit seinen selbst verfassten Kärntner Mundartgedichten das diesjährige Kärntner Adventkonzert.
Die Begrüßung der zahlreichen Gäste galt unter anderem dem stellvertretenden Kommandanten der Militärakademie, Brigadier Mag. Franz Hollerer, sowie dem LTgAbg. und StR DI Franz Dinhobl.
Der zwischen den einzelnen Darbietungen gesammelte Applaus entlud sich nach dem Schlussakkord besonders stürmisch und bewirkte eine zweite Zugabe der Villacher Sängerunde Fellach Oberdörfer, ehe sich die Konzertgäste verabschiedeten.
Mit dem Programm wurde auch bereits zu den nächsten beiden Kärntner Adventkonzerten eingeladen:
12. Dezember 2026 mit dem Männergesangverein Petzen-Loibach
11. Dezember 2027 mit dem Männergesangverein Afritz
Bericht: Obst i. R. Hans Machowetz, ehemaliger langjähriger stellvertretender Militärpfarrgemeinderat und aktiver Angehöriger der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten an der Theresianischen Militärakademie
Im Rahmen des Lebenskundlichen Unterrichts (LKU) für Funktionssoldaten führte Militärdekan Oliver Hartl die Rekruten des Einrückungstermins Juli 2025 der Stabskompanie des Jägerbataillons 12 am 10. Dezember 2025 in das Stift Seitenstetten. Ziel der Exkursion war es, den LKU einmal außerhalb des Lehrsaals erlebbar zu machen.
Im Stift wurden die Soldaten von P. Vitus Weichselbaumer OSB empfangen, der mit den Kameraden einen ausführlichen Rundgang durch die Klosteranlage unternahm. Dabei erhielten die Rekruten auch Einblicke in Bereiche, die im Rahmen einer gewöhnlichen Stiftsführung nicht zugänglich sind. Aus persönlichen Erfahrungen und ehrlichem Interesse heraus entwickelten sich zahlreiche Fragen, die von P. Vitus sowie Militärpfarrer Hartl ausführlich erläutert und beantwortet wurden.
Neben der Stiftskirche, der Bibliothek und dem Museumsbereich durften die Rekruten auch einen Blick in das Stiftsgymnasium werfen – für einige eine Gelegenheit, Erinnerungen an die eigene Schulzeit aufleben zu lassen.
Den Abschluss bildete ein gemeinsames Mittagessen im Gästespeisesaal des Stiftes, zu dem die Militärpfarre eingeladen hatte. In entspannter und offener Atmosphäre klang der auf einen Halbtag geblockte Lebenskundliche Unterricht aus – diesmal bewusst fernab des gewohnten Lehrsaalbetriebs.
Bericht: Militärdekan Oliver Hartl
450 Kinder erwarteten den Hl. Nikolaus, der am Nachmittag des 4. Dezembers eigens mit einem Transporthubschrauber des Typs Augusta Bell 212 am Fliegerhorst Vogler eingeflogen wurde. Direkt nach der Landung wurde der hohe Gast von Militärkommandant Brigadier Dieter Muhr begrüßt. Der Präsident der Unteroffiziersgesellschaft OÖ stellte dem Heiligen Bischof ein Engerl vor, das anschließend beim Austeilen der Gaben gemeinsam mit unserem Militärseelsorger behilflich war. Neben der Bescherung der Kinder mit gut gefüllten Säckchen gab es auch ein Löffelgericht, Würstel und verschiedene heiße Getränke zu genießen.
In Kooperation mit der Unteroffiziersgesellschaft und der Personalvertretung konnte die Militärpfarre beim Militärkommando OÖ – unter tatkräftiger Mithilfe vieler am Fliegerhorst stationierter Einheiten – eine gelungene Nikolofeier ausrichten. Der Reinerlös aus den freiwilligen Spenden kommt in Not geratenen Kameradinnen und Kameraden sowie Kolleginnen und Kollegen zugute.
Weitere Bilder zu dieser Feier finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/events-bundesheer/albums/72177720330639940/
Rückblick auf die Gottesdienstübertragung aus der Soldatenkirche der Schwarzenberg-Kaserne am zweiten Adventsonntag
Am Sonntag, 7.12.2025, übertrug ServusTV österreichweit live den Gottesdienst aus der Soldatenkirche der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg-Walserfeld. Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer bot sich damit erstmals die Gelegenheit, die besondere Atmosphäre dieses Gotteshaus mitzuerleben – und für die Gemeinde vor Ort war es ein festlicher Rahmen für den zweiten Adventsonntag.
Mut im Advent – eine Einladung
Die Feier, die Militärdekan Richard Weyringer mit den Gläubigen hielt, begann um 8.55 Uhr. In seiner Predigt rückte er das Thema Mut ins Zentrum: Was macht einen Menschen mutig? Und warum braucht es gerade im Glauben immer wieder Entscheidungen, die über das Gewohnte hinausführen? Weyringer erinnerte daran, dass Christen aufgerufen sind, Neues zu wagen, Risiken nicht zu scheuen und im Vertrauen zu wachsen. Maria, sagte er, sei dafür ein eindrucksvolles Vorbild – ihr Ja zu einer schwierig nachvollziehbaren Botschaft bleibe bis heute ein Zeichen wahrer Glaubensstärke. Der Advent lade daher jedes Jahr aufs Neue ein, sich innerlich auf den Weg zu machen und mutig neue Schritte zu setzen.
Musik, die trägt
Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Blechbläserensemble der Militärmusik Salzburg unter Oberstabswachtmeister Florian Fletschberger gestaltet. Gemeinsam mit dem Volksmusikensemble unter der Leitung von Wachtmeister Markus Brodinger und dem Kirchenchor der Seelsorgestelle Walserfeld, geführt von Hilde Brötzner, entstand ein besonders feierlicher Klangraum. Franz Mayrhofer an der Orgel rundete die musikalische Gestaltung ab.
Ein Gotteshaus mit Geschichte
Die Soldatenkirche selbst trägt eine bewegte Geschichte in sich. Errichtet wurde sie von den amerikanischen Besatzungstruppen, und bereits zu Weihnachten 1954 fand hier der erste Gottesdienst statt. Von Beginn an war sie als Simultankirche gedacht – offen für alle christlichen Konfessionen. Für Soldaten jüdischen Glaubens stand ein eigener Gebetsraum zur Verfügung, der heute als evangelischer Gebetsraum genutzt wird.
Sie können die Aufzeichnung des Gottesdienstes "nachanschauen" unter https://www.servustv.com/kultur/v/aafya90q8s1inqtttvs9/
Quellen: Heilige Messe aus der Soldatenkirche in Salzburg-Walserfeld - ServusTV On
Gottesdienst aus Militärpfarre im TV (Rupertusblatt)
35 Kinder und Enkelkinder unserer Bundesheerbediensteten erlebten heuer einen ganz besonderen Kindernikolaus in der Standschützenkaserne. Die Unteroffiziersgesellschaft und die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Kettenbrücke hatten ein liebevoll gestaltetes, vorweihnachtliches Stationsprogramm vorbereitet – voller kleiner Überraschungen und Momente, die man nicht so schnell vergisst.
Nach einer stimmungsvollen Andacht mit Militärsuperior Gmachl-Aher wurde es dann richtig festlich: Begleitet von der Militärpolizei zog der Nikolaus ein und ließ viele Kinderaugen strahlen.
Wer noch mehr Eindrücke des Nachmittags sehen möchte, findet weitere Bilder unter https://flic.kr/s/aHBqjCCFEb
Advent – Bedeutung und gelebte Tradition…
Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...
WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat
Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...
Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävent…
Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale...
WeiterlesenChristophorus – Schutzpatron der Reisend…
Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem...
WeiterlesenHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne
Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…
Informationen aus der Kirche29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus
Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…
Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie
Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…
Informationen aus der Kirche
Fronleichnam kurz gefasst
Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…
Informationen aus der KirchePfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest
Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…
Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?
Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…
Informationen aus der Kirche
14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los
Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…
Informationen aus der KircheLeo XIV.: Wissenswertes rund um die feierliche Amtseinführung des neuen Papstes
Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei…
Informationen aus der KircheMit Maria durch den Mai – Ein Monat der Hoffnung und Hingabe
Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger…
Informationen aus der Kirche
- 1
- 2
- 3
Empfehlungen
Weihnachtsbotschaft 2025

Wien, im Dezember 2025 Liebe Schwestern und Brüder! In dem 1931 erschienenen Buch „Die Religion im Weltkrieg“ findet sich eine bemerkenswerte Notiz über Probleme religiöser Soldaten mit ihrem persönlichen Gottesglauben im Ersten... Weiterlesen
Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen
Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen
13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen
66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen
24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen
Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen
Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen
65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen
Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen
Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen
Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen
"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen
HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen
Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen
Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen
Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen
Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen
Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen
Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen
Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen
Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen
Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen
Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen
Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen
Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen
Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen
Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen
Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen
25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen
Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen
Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen